Wir reden seit Jahren von den Entwicklungen einer neuen Arbeitswelt, Arbeit 4.0 oder gar von New Work. Im Kern, im Maschinenraum von sozialen Organisationen und Bildungseinrichtungen hat sich jedoch wenig bis nichts geändert. Ja, es gibt einige Vorreiter (die im Übrigen sehr gut durch die Krisenzeiten gekommen sind), aber viele Organisationen haben noch nicht einmal von den sich vollziehenden Entwicklungen gehört, geschweige denn daraus konstruktive Schlüsse gezogen. Man könnte diesen Beitrag als erneuten Wink mit dem Zaunpfahl, nein, eher als Wink mit der Zaunfabrik vergleichen: Liebe soziale Organisationen, es wird Zeit! Es ist richtig dringend, es ist 12! Beschäftigt euch mit euren Wertschöpfungsstrukturen, mit den Funktionsweisen selbstbestimmt arbeitender Teams, mit „agiler“ Zusammenarbeit und dem, was unter kollektiver oder kollegialer Führung verstanden wird. Beschäftigt euch mit eurer Zukunft! Warum? Das kannst Du hier lesen.
Kategorie: Visionäres
Die IdeeQuadrat-Strategie 2025, oder: Verführungen am äußeren Rand der Panikzone
tl:dr: Ich mache mich mit IdeeQuadrat im Jahr 2022 – also jetzt – komplett selbständig. Ich verlasse meine Komfortzone und begebe mich in neue Abenteuer am Rande der Panikzone und weiter. Das ist mit Blick auf die Historie nachvollziehbar: Mit IdeeQuadrat bin ich schon eine Weile unterwegs. Mein Fokus hat sich dabei nicht geändert. Ich bin immer noch und zunehmend überzeugt davon, dass Soziale Organisationen, Bildungseinrichtungen und kommunale Verwaltungen „New Work Vorreiter“ sein können (wenn nicht gar müssen). Und am Rande der Panikzone – in meiner Arbeit – will die Organisationen dahin verführen, ihren Zweck bestmöglich zu erfüllen. Hinzu kommen Bildungsangebote und die Begleitung bei der Projektentwicklung. Kurz: Hier ist meine IdeeQuadrat-Strategie für die kommenden Jahre.
Der New Work Gap, oder: Warum wir miteinander reden müssen!
Im letzten Werkraum Zukunft, der dem Thema Jahresrück- und -ausblick gewidmet war, haben wir uns intensiv mit Fragen der Digitalisierung in der Pandemie auseinandergesetzt:
Wir haben übergreifend gesprochen: Wie gelingt Digitalisierung? Woher kommen Mittel zur Gestaltung der Digitalisierung? Und wir sind konkret abgetaucht: Gelingen hybride Veranstaltungen und wenn ja, wie? Wie akzeptiert ist Blended Counseling und warum zählt die Perspektive der Berater_innen nicht so sehr wie die Perspektive der Nutzer_innen? Wie lassen sich auch Blended Consulting Projekte in der Organisationsentwicklung neu und zielführend gestalten?
Worüber reden wir genau?
Diese und mehr Fragen haben eine grundlegende Herausforderung aufgezeigt, die (nicht nur) mit Fragen gelingender Digitalisierung einhergehen:
- Worüber reden wir genau?
- Wer versteht was genau unter dem Begriff der Digitalisierung?
- Und wie kann es gelingen, ein gemeinsames Verständnis dessen herzustellen, um das es geht? Mehr noch:
- Wie kann sich die Gesellschaft (gibt es sowas eigentlich?) hinsichtlich ihrer enorm weit auseinandergehenden digitalen Kompetenzen – dem digital gap – annähern?
Der New Work Gap
Die letzte Frage lässt sich erweitern auf grundlegende Herausforderungen unserer Gesellschaft, und nein:
Unsere Gesellschaft ist nicht gespalten. Vielmehr schreit ein kleiner Teil der Gesellschaft laut, weil er auf einfache Antworten auf hoch komplexe Fragen hofft. Diese einfachen Antworten kann es aber nicht geben. Und ich will hier nicht über irgendwelche Impfdebatten sprechen…
Aber: Es ist festzustellen, dass es Entwicklungen gibt, die enorm weit auseinandergehen:
Digitale Vorreiter entwickeln selbstfahrende Autos und haben seit Jahren ihre Organisation, für die sie arbeiten, nicht mehr von innen gesehen, wohingegen andere Bereiche der Gesellschaft und der Organisationen auf Teufel komm raus an analoger Präsenz festhalten und damit notwendige Entwicklung verhindern – der schon angesprochene digital gap.
Diesen gap gibt es aber auch in vielen anderen Bereichen:
So stelle ich in meiner eigenen Arbeit regelmäßig fest, dass es alles andere als selbstverständlich ist, sich mit „New Work“, mit Arbeits- und Lebenswelten der Zukunft zu befassen.
Das ist ein new work gap oder new work divide, wenn man so will…
In seiner je eigenen Blase herrscht die Vorstellung, dass alles so bleiben kann, wie es die letzten 30 Jahre war und man bestärkt sich gegenseitig, dass es so ist, wie es ist. Logisch bin ich davon überzeugt, dass dem nicht so ist, damit verdiene ich ja mein Geld 😉
Aber worauf will ich hinaus?
Denkräume gestalten, um Zukunft zu entwickeln
Ich will darauf hinaus, dass es Räume und Zeiten braucht, in denen wir uns aufeinander verständigen, neue Ideen entwickeln, miteinander in Kontakt kommen, Dialoge führen. Wir brauchen die Verständigung, um die gaps unserer Gesellschaft zu schließen.
Sabine spricht im Werkraum Zukunft ihren Wunsch für das Jahr 2022 aus:
Sie will Denkräume, um reflektieren zu können, was wirklich neu gedacht und dann auch gemacht werden muss. Eigentlich logisch: Wir können und werden – hoffentlich – nicht dahin zurück gehen, wo wir vor der Pandemie standen. Wir werden uns hoffentlich weiterentwickelt haben – nicht nur, was die Nutzung digitaler Tools oder irgendwelche New Work Ideen, sondern was unsere Gesellschaft betrifft.
Ich kann mich der Idee der Denkräume nur anschließen:
Es braucht Raum, um sich in den unterschiedlichen, oben skizzierten Feldern gesellschaftlicher und organisationaler Entwicklung zu verständigen:
- Über was reden wir, wenn wir Thema XY ansprechen?
- Was ist der Status Quo und wo wollen wir hin?
- Wie könnte es dort, in dieser Zukunft, aussehen?
- Und was müssen wir tun, damit wir die positive Zukunft gestalten?
Denn, so viel ist klar:
„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“
Alan Kay
Slack, oder: Wir brauchen Fettpolster
Aber Denkräume zum Schließen der gaps brauchen Ressourcen. Zeit zum Denken braucht – genau – Zeit und Menschen, die sich auf neue Gedanken, Wege, Ideen und Unsicherheit einlassen.
Jedoch ist mit Blick auf Organisationen im Sozial- und Gesundheitswesen in der Pandemie festzustellen, dass keine freien Ressourcen, sogenannte Slack Ressources, vorhanden sind und waren, um Mehrbelastung abzufedern geschweige denn zum Neudenken und -machen anzuregen.
Unter Slack sind organisatorische „Fettpolster“ zu verstehen:
„Eine Armee hält sich Ersatzteile für Panzer auch dann vorrätig, wenn kein militärischer Konflikt bevorsteht. An zentralen Bahnhöfen unterhalten halten staatliche Verkehrsbetriebe Pools von Technikern, die komplizierte Fehlerquellen beseitigen können, auch wenn deren Qualifikationen nur selten nachgefragt wird. Ein Landkreis erklärt sich bereit Krankenhausbetten zu finanzieren, die nicht permanent gebraucht werden, um auf eine Katastrophe oder eine Pandemie eingestellt zu sein.“ so Stefan Kühl.
Noch einmal:
In Sozialen Organisationen fehlen diese Fettpolster. Soziale Organisationen agieren am Limit und viel weiter. Die Burnoutstatistik im AOK Fehlzeitenreport sagt alles: Wir sind Burnout-Spitzenreiter!
Overhead-Fettpolster
Aber die fehlenden Fettpolster zeigen sich nicht nur in der operativen Arbeit „am Menschen“, wo der Fachkräftemangel unsere Gesellschaft noch richtig hart treffen wird.
Fehlender Slack zeigt sich auch auf den Management-Ebenen der Organisationen: In Organisationen der Sozialen Arbeit sind keine Mittel zur Finanzierung eines angemessenen Overheads vorhanden, der in der Lage ist, die Zukunft der Organisationen zu gestalten.
Und nein, mit „angemessenem Overhead“ meine ich nicht das Business-Theater und die sinnlose Aufblähung von Abteilungen, die die Beschäftigung der Organisationen mit sich selbst fördern. Ja, natürlich braucht es Controlling und QM, aber bitte nicht als Fettpolster.
Wir brauchen vielmehr Slack verstanden als Ressourcen für Menschen und Möglichkeiten, die nicht in der operativen Arbeit untergehen. Wir brauchen Menschen und Möglichkeiten, um Zukunft zu denken, anzustoßen und zu gestalten – genau:
Wir brauchen Denkräume.
Als negatives Beispiel für fehlenden Overhead sozialer Organisationen sind die meisten Stabsstellen zum Thema Digitalisierung projektfinanziert. Während privatwirtschaftliche Organisationen den oder die CDO einstellen, ist in vielen, vor allem den kleinen und mittleren Organisationen, nach drei Jahren Schluss, Ende im Gelände, Schicht im Schacht mit Digitalisierung.
Wer Digitalisierung so denkt, hat eine zeitgemäße Kultur der Digitalität nicht im Ansatz verstanden.
Das muss sich ändern, dringend. Und ja, das ist ein Plädoyer an die Politik, in die Ressourcenausstattung sozialer Organisationen zu investieren.
Miteinander reden
Dazu aber – ich komme zum Miteinander reden zurück – ist wiederum gemeinsames Verständnis von Kostenträgern und Leistungserbingern erforderlich, um verstehen zu können, wer welche Herausforderungen zu bewältigen hat.
In einem der letzten Beiträge habe ich geschrieben, dass sich „die Codes und Funktionsweisen von Sozialen und Bildungsorganisationen (…) radikal von denen der Sozialleistungsträger und für Bildung zuständigen Amtsstrukturen [unterscheiden]. Die einen sind im Kern auf die Gestaltung von Komplexität, die anderen auf die regelbasierte Abarbeitung von (gesetzlichen) Vorgaben, Plänen und die Kontrolle der Einhaltung von Regeln ausgerichtet.“
Das passt (noch) nicht zusammen. Die Logiken der Systeme agieren diametral entgegengesetzt. Um zusammen Ressourcen für die Gestaltung der Zukunft zu generieren, muss es zunächst Zuhören, Verständigung geben. Denn Veränderung braucht Ressourcen. Und diese kommen in sozialen Organisationen nunmal nicht von den „Kunden“, sondern sind im Wesentlichen öffentliche Mittel.
Wenn wir aber wollen, dass unsere Gesellschaft über ein zukunftsfähiges, nicht nur system-, sondern lebensrelevantes Gesundheits- und Sozialwesen verfügt, müssen wir in die Entwicklung der Organisationen investieren. Denn klar ist:
Egal welche Veränderung, für die keine Mittel vorhanden sind und die mal eben so nebenbei gemacht werden soll, ist zum Scheitern verurteilt.
P.S.: Der nächste Werkraum Zukunft findet am 20.01.2022 statt. Hier kannst Du Dich zum Newsletter anmelden, um informiert zu bleiben.
P.P.S.: Interessant bzgl. des Zuhörens sind die vier Arten des Zuhören von Otto Scharmer.
Werte und Prinzipien, oder: Warum ihr mehr als ein Leitbild braucht!
Jede Organisation braucht ein Leitbild. Diese Aussage wird vermutlich jede*r unterschreiben? Dabei ist unklar, was genau unter einem Leitbild zu verstehen ist. Ich definiere Leitbild umfassend als Kombination aus Vision, Mission, Werten und Strategien einer Organisation. Mein Verständnis eines Leitbilds geht damit über lustige Sprüche am Eingang oder die irgendwo herunterladbare PDF hinaus. Ein Leitbild sollte vielmehr der Kern einer Organisation sein, der definiert, wozu die Organisation angetreten ist (Vision und Zweck), anhand welcher Werte und Prinzipien sie wie arbeiten will und was konkret die Organisation heute und in Zukunft umsetzen will (Strategie). Da sich insbesondere Werte und Strategien, aber auch die Vision ändert, ist meine Leitbilddefinition lebendig.
Leider leben Leitbilder leidlich…
Wenn Organisationen überhaupt ein Leitbild entwickelt haben, ist schon viel gewonnen. Wenn sich das Leitbild dann noch an dem skizzierten Aufbau von Vision, Mission, Werten und Strategien orientiert, ist es noch besser.
Die Herausforderung besteht jedoch in der Übersetzung des „global formulierten“ Leitbilds auf die Abteilungen, Teams bzw. in komplexen Organisationen der sozialen Arbeit in die Unterorganisationen. Erst dann wird es für die Mitarbeiter*innen und hoffentlich auch für die Nutzer*innen wirklich lebendig und entfaltet seine Wirkung in der Organisation (Leitbilder wirken übrigens auch auf der Schauseite der Organisation und haben einen Nutzen für die Außenwirkungen, vgl. bspw. Kühl, 2016).
Das Leitbild der Gesamtorganisation hat damit grobe Orientierungsfunktion. Und selbst auf dieser Ebene: Kennst Du das Leitbild Deiner Organisation? In welcher Organisation ist das Leitbild wirklich präsent?
Strategie wird über Objectives and Key Results lebendig
Bezogen auf Übersetzung der Strategie auf die Teamebene gibt es inzwischen Methoden und Frameworks, die sicherstellen sollen, dass auch auf Teamebene tatsächlich an der Strategie und nicht an irgendwas gearbeitet wird. Das Management-Framework „Objectives and Key Results“ (OKR) habe ich hier beschrieben.
Ein schöner Beitrag dazu findet sich auch im Blog von Sebastian Ottmann, in dem wir (Christian Müller, Sebastian Ottmann und ich) über „Social Objectives and Key Results (SOKRs)“ geschrieben haben.
Das Framework OKR klärt in der Gesamtorganisation, was bis wann von wem bearbeitet wird bzw. werden sollte, um die Vision der Organisation zu erreichen.
Unklar bleibt aber, wie die Zusammenarbeit erfolgen soll. Denn die im Leitbild der Gesamtorganisation global formulierten Werte sind noch nicht greifbar, lebendig und übersetzt auf den Alltag der Abteilungen, Teams und der einzelnen Menschen im Unternehmen.
Von globalen Werten zu Prinzipien der Zusammenarbeit
Hier hilft es, die global formulierten Werte heranzuziehen und diese in Prinzipien für die gemeinsame Arbeit zu spezifizieren.
Um es konkret zu machen ein Beispiel aus einem Leitbild eines großen, konfessionellen Komplexträgers der Sozialwirtschaft mit mehr als 3000 Mitarbeiter*innen. In dessen Leitbild heißt es unter anderem:
„Wir leisten unseren Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung.“
Das ist unmittelbar einleuchtend und in der heutigen Zeit angesichts des Klimawandels unabdingbar. Aber was heißt der Wert der ökologischen Nachhaltigkeit, der im Leitbild der Gesamtorganisation dieser Aussage zugrunde liegt, für den Alltag in einem Team – bspw. in der Jugendhilfe?
Denkbar wäre jetzt, gleiche Vorgaben für alle Teams zu beschließen, die den Umgang mit den Ressourcen regeln: „Abends ab 20 Uhr sind die Heizungen zu drosseln!“ oder „Die Raumtemperatur muss zwischen 20 und 22 Grad liegen!“ wären zwar denkbare, aber ziemlich absurde Regeln. Schon hier fällt auf, dass solche Regeln ziemlicher Quatsch wären.
Wenn es im Winter richtig kalt wird, macht es Sinn, die Heizungen vielleicht nach 20 Uhr anzulassen und die Raumtemperatur kann auch durch die Sonneneinstrahlung beeinflusst werden, wodurch die Regel noch nicht mal in alleiniger Macht der Mitarbeiter*innen liegt.
Regeln und Vorgaben sind unflexibel und oftmals unpassend zur Situation.
Es braucht vielmehr Prinzipien der Zusammenarbeit, die einfach, verständlich und gleichzeitig handlungsleitend für die Entscheidungen im Team sind. Denkbar wäre hier bspw., im Team das Prinzip zu definieren
„Wir handeln so effizient wie möglich im Sinne der Jugendlichen!“
Damit ist zum einen klar, um wen es geht (die Nutzer*innen), zum anderen bleibt individueller Spielraum, selbstbestimmt zu entscheiden, was in der jeweiligen, sich immer wieder ändernden Situation so effizient wie möglich ist.
Heuristiken als Alternativen zu Prinzipien
Denkbar ist hier auch, anstatt der Prinzipien sogenannte Heuristiken anzuwenden. Darunter lassen sich Hilfestellungen verstehen, „die es erlauben, mit begrenztem Wissen und unter Zeitdruck Entscheidungen zu treffen.“ (vgl. https://newworkglossar.de/)
Die vier Werte im agilen Manifest sind bspw. als Heuristiken formuliert:
- Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
- Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
- Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
- Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
Ausgesagt wird, dass der erste Teil der Aussage wichtiger ist als der zweite Teil (wobei der zweite nicht unwichtig ist).
Im ersten Wert „Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge“ wird betont, dass Individuen und Interaktionen höher gewertet werden als Prozesse und Werkzeuge. Entsprechend kann in unklaren Entscheidungssituationen hier Orientierung gefunden werden. Übrigens habe ich auch die 6 Thesen zur Zukunft Sozialer Arbeit als Heuristiken formuliert.
Werte und Prinzipien helfen, wirkungsvoll und selbstbestimmt zu handeln
Deutlich wird: Führungskräfte können nicht erwarten, dass Mitarbeiter*innen selbstbestimmt entscheiden, wenn völlig unklar ist, woran sich die Entscheidung orientieren soll. Diese Orientierung kann über Heuristiken oder Prinzipien gegeben werden, die auf Ebene der Teams Werte (im Beispiel Jugendhilfe der Wert der Nachhaltigkeit und im Beispiel agiles Manifest die agilen Werte) in handlungsleitende Prinzipien übersetzen. Erst mit dieser Orientierung kann wirkungsvoll und selbstbestimmt agiert werden.
Im Gegensatz zu meist durch die Vorgesetzten oder äußere Bedingungen (bspw. Brandschutzvorgaben) festgelegte Regeln ist es notwendig, Prinzipien in einem dialogischen Prozess im Team bzw. auf Ebene der unmittelbar Betroffenen auszuhandeln, um im jeweiligen Kontext wirksam zu werden.
Das gilt im Übrigen nicht nur für Organisationen, sondern auch für Gesellschaften, aber das ist ein anderes Thema…
Werte und Prinzipien dialogisch aushandeln
Wie auch auf Ebene der Gesamtorganisation macht es auf Teamebene Sinn, sich vom gemeinsamen Zweck des Teams („Wozu sind wir da? Warum existieren wir als Team in dieser Organisation? Was ist unser Zweck und Auftrag?“) über die gemeinsamen Werte (Welche Werte sind uns in unserer Zusammenarbeit wirklich wichtig?) hin zu den konkreten, aus der Strategie abgeleiteten Zielen und Aufgaben („Was ist die konkrete Aufgabe? Wer ist verantwortlich?“) vorzuarbeiten.
Herauskommen kann so etwas wie das „Teamleitbild“, der gemeinsame Leitfaden der Zusammenarbeit, sowas wie die „10 Prinzipien unserer Arbeit“ oder die Leitlinien von Team XY. Wichtiger als der Titel ist, die Prinzipien so einfach und schlank wie möglich zu halten, um den Spielraum der Mitarbeiter*innen nicht unnötig einzuschränken.
Prinzipien lebendig halten
Abschließend ist relevant, die Prinzipien der Zusammenarbeit zum einen möglichst präsent zu halten. In Teamsitzungen, Gesprächen unter Mitarbeiter*innen und Führungskräften ebenso wie in Gesprächen mit Klient*innen sollten die Leitlinien angewendet werden. Ansonsten besteht die Gefahr, ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie viele vergilbte Leitbilder vieler Organisationen: Zwar existent, aber alles andere als lebendig.
Zum anderen sind die Prinzipien nicht nur im Team zu entwickeln, sondern auch iterativ weiterzuentwickeln. Das Team sollte in bestimmten Abständen (bspw. einmal im Jahr) die Prinzipien selbst in den Blick nehmen und überlegen, ob sie noch Gültigkeit besitzen oder angepasst werden müssen.
Viele Leitbilder helfen, Diversität zu leben und Organisationskulturen sichtbar zu machen
Mit eigens formulierten „Leitlinien“ oder Teamleitbildern entsteht früher oder später ein enorm diverses „Biotop“ an lebendigen Werten und Prinzipien in der Organisation.
Die vielfältigen Unternehmenskulturen einer Organisation werden sichtbar.
Als Führungskraft gilt es, dies auszuhalten: Nein, wir müssen nicht alle gleich sein, es darf, kann, soll (und muss sogar) Unterschiede geben. Und mal ehrlich:
Diese Unterschiede gab es schon immer. Jetzt dürfen sie nur offensiv im Sinne der Organisation gelebt werden.
P.S.: Wie wäre es mit dem Prinzip, sich an die Vereinbarungen im Team zu halten? Dahinter steht der Wert der Verbindlichkeit. Ohne Verbindlichkeit, neudeutsch Committment, machen alle niedergeschriebenen Werte und Prinzipien keinen Sinn.
Open Strategy in der Praxis – die fünf wichtigsten Fragen
Vor einem Jahr habe ich einen Beitrag zum Thema „Open Strategy in der Sozialwirtschaft“ geschrieben. Das war eher ein Überblicksartikel. Hier erfährst Du, wie der Ansatz „Open Strategy in der Praxis“ aussieht und vor allem, welche fünf Fragen zu klären sind, um einen guten „Open Strategy Process“ zu designen.
Dazu gehe ich kurz auf die Frage ein, was eine Unternehmensstrategie ist, was den Open Strategy Ansatz so besonders macht und welche fünf wichtigsten Fragen in der Praxis für einen guten Open Strategy Process zu beantworten sind.
Was ist eine Unternehmensstrategie?
Open Strategy, schön und gut, aber was ist (Unternehmens)Strategie überhaupt? Ohne in die Tiefe zu gehen ist die Frage nicht ganz trivial. So gibt es keine einfache, richtige Antwort. Ich fasse hier den Begriff Strategie in Anlehnung an Kühl (2016) als die Bestimmung von Zwecken einer Organisation, für die dann Mittel gesucht werden:
„Bei der Vorgabe, jedes Jahr ein Return on Investment von 15 Prozent zu erreichen, handelt es sich ebenso um ein Zweckprogramm, mit dem die Suche nach Mitteln mobilisiert wird, wie bei dem Befehl an einen Geldeintreiber der Mafia, bei Restaurants in einem Stadtviertel wöchentlich das Schutzgeld einzusammeln“
Kühl, 2016, 28
Was macht Open Strategy so besonders?
Ganz grob lässt sich Open Strategy als Strategieentwicklungsansatz definieren, der möglichst viele Interessengruppen der Organisation in die Strategieentwicklung einbezieht.
Der Ansatz ist die Abkehr von der Norm, dass Strategien immer von oben – dem oberen Management – zu entwickeln sind. Open Strategy wird zum inklusiven und transparenten Ansatz, bei dem möglichst alle, interne wie externe, Stakeholder der Organisation miteinbezogen werden.
Hinzu kommt, dass die Strategie nicht nur nach innen, sondern auch nach außen transparent dargestellt wird. So gelingt es, kontinuierlich Feedback der Umwelt aufnehmen zu können.
Bei diesem Ansatz agiler Strategieentwicklung sind mir vor allem die folgenden Aspekte positiv und gerade für soziale Organisationen, Bildungseinrichtungen, Verwaltungen und NPO enorm gewinnbringend aufgefallen:
- Das Interesse der Öffentlichkeit (Gesellschaft, Politik…) an den Entwicklungen der genannten „besonderen“, im Wesentlichen durch öffentliche Gelder finanzierten Organisationen ist höher als das Interesse an „privat“ finanzierten Wirtschaftsorganisationen.
- Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen sind komplex. Und der Umgang mit Komplexität gelingt nur gemeinsam, im Austausch, im Abgleich der Interessen, in Kooperation, im Wir. Konkret: Wenn man bspw. Digitalisierung als ein Strategiefeld der aktuellen Unternehmensstrategie formuliert hat, macht es Sinn, nicht ausschließlich die IT-Abteilung mit der Umsetzung zu beauftragen. Es macht Sinn, die Entwicklung, Veröffentlichung und Umsetzung (nicht nur) des Themas Digitalisierung mit möglichst vielen Interessengruppen gemeinsam in crossfunktionalen Teams zu verwirklichen.
- Mitarbeiter*innen sozialer Berufe definieren sich stark über ihren Beruf, ihre Profession. Die berufliche Identität ist ein viel diskutierter Aspekt Sozialer Arbeit. Entsprechend interessieren sich die Mitarbeiter*innen für die Mitgestaltung der zukünftigen Ausrichtung der Organisation. Hinzu kommt, dass die Strategieumsetzung ohne die Mitarbeiter*innen nicht denkbar ist.
- Soziale Organisationen, genauso wie Bildungseinrichtungen oder NPOs, sind „front-line organizations“. Die soziale Wertschöpfung findet an der Basis, in der konkreten Arbeit „mit Menschen“ statt. Die Menschen jedoch, die die Arbeit „an der Basis“ leisten, nicht (oder kaum) in den Entwicklungsprozess der Strategie mit einzubeziehen, ist fahrlässig.
- Angesichts einer notwendigen Komplexitätssteigerung im Inneren der Organisationen aka Selbstorganisation als Reaktion auf die Komplexitätssteigerung im Außen wird der Ruf nach selbstbestimmt, eigenverantwortlich oder gar autonom arbeitenden Teams und Mitarbeiter*innen immer lauter. Wie jedoch sollten Mitarbeiter* innen selbstorganisiert arbeiten können, wenn ihnen eine Strategie vor die Nase gesetzt wird, an der sie nicht im Ansatz beteiligt waren? Gelingende Selbstorganisation erfordert Transparenz und Beteiligung – und das gilt entsprechend für den Prozess der Entwicklung, Veröffentlichung und Umsetzung der Strategie. Aus Transparenz und Beteiligung erfolgt selbstorganisiert Strategieumsetzung.
Überzeugt?
Vielleicht…
Open Strategy in der Praxis – fünf Fragen
Welche Fragen aber sind vor einem Open Strategy Process in der Praxis zu klären? Wie sollte der Prozess aufgesetzt sein? Wie ist ein gutes Open Strategy Process Design (Akronym hab ich gerade erfunden: OSPD ;-)?
Um die Fragen bis hin zum OSPD (ich nutze das jetzt öfter) zu beantworten, gibt es seit Oktober 2021 das enorm hilfreiche Buch „Open Strategy – Mastering Disruption from Outside the C-Suite“ von Christian Stadler, Julia Hautz, Kurt Matzler und Stephan Friedrich von den Eichen.
Die folgenden Ausführungen habe ich dem Buch entnommen und zusammengeführt mit meinen Erfahrungen aus der Strategieentwicklung in verschiedenen Organisationen.
Da es nicht sinnvoll ist, kopflos in einen Strategieprozess zu starten, ist die Beantwortung der folgenden Fragen vor Beginn der Strategiearbeit wichtig
1. Wie offen soll der offene Strategieentwicklungsansatz sein?
Ja, es heißt open strategy, aber klar ist, dass es nicht für jeden Prozess, für jede Organisation und jeden Prozessschritt hilfreich ist, Gott und die Welt einzubeziehen. Die Steuerung des Prozesses wird aufwendiger, je mehr Personen und Gruppen einbezogen werden. Fraglich ist auch, wie „disruptiv“ die neue Strategie sein soll oder ob sich die Organisation weiterhin in ihrem angestammten Geschäftsfeld bewegen will (wogegen nichts einzuwenden ist, sofern die Umwelt, das eco-system der Organisation, berücksichtigt wird).
Als Fautregel lässt sich festhalten: Je disruptiver die Strategie sein soll, desto mehr Stakeholder(gruppen) sollten insbesondere zu Beginn (Sammlung) involviert werden, um mehr Aspekte abdecken zu können.
2. Sollen neben internen auch externe Stakeholder involviert werden?
Es ist immer sinnvoll, Menschen zu beteiligen, die nicht unmittelbar in der Kultur der Organisation „beheimatet“ sind. Diese etwas sperrige Formulierung deutet darauf hin, dass „Externe“ nicht auch Mitglieder der Organisation sein können. Vielmehr geht es darum, außerhalb bestehender Vorgaben, ausserhalb des Standards, außerhalb der Kultur denken zu können. Das können bspw. neue Mitarbeiter*innen (noch) wunderbar.
Und bei einem Träger mit mehr als 3.000 Mitarbeiter*innen finden sich sicherlich Menschen, die nicht dem „kulturellen Standard“ entsprechend. Falls aber alle Mitarbeiter*innen von der Culture gefrühstückt wurden: Außerhalb suchen und andere Interessengruppen einbinden.
Meine Idee ist ja immer, Leistungsträger, Kommunen, Krankenkassen etc. explizit in die Strategieentwicklung der eigenen Organisation mit einzubinden. Daraus kann ein neues Verständnis voneinander im Sinne von echtem Verstehen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten und damit ein gemeinsames Lernen werden.
3. Wie viele Personen sollen in die Entwicklung der Strategie eingebunden werden?
Ja, es gelingt auch, bei einer kleinen Gruppe von Stakeholdern, die sich an der Strategieentwicklung beteiligen, eine möglichst hohe Diversität sicherzustellen: Durch gezielte Auswahl der zu beteiligenden Stakeholder(gruppen) lässt sich die zu beteiligende Anzahl gut steuern. Auch macht eine größere Gruppe Sinn, wenn zu Beginn des Prozesses neue Ideen offen generiert werden sollen.
Eine kleinere Gruppe arbeitet hingegen deutlich fokussierter und eignet sich entsprechend gut für die Ausformulierung konkreter, strategischer Themenfelder und Ziele. Eine möglichst große Gruppe macht dann wieder Sinn, wenn die Strategie implementiert und umgesetzt werden soll.
4. Werden die zu beteiligenden Menschen explizit ausgewählt oder können sich die Personen basierend auf einer offenen Einladung beteiligen?
Die Antwort scheint klar zu sein: Kleine Gruppe = explizite Auswahl, große Gruppe = offene Einladung. Aber es ist darüber hinaus möglich, die offene Einladung zu ergänzen um gezielte Einladungen von Stakeholdern, die – geplant oder zufällig – andere Menschen zur Teilnahme inspirieren. Dazu noch zwei Aspekte: Wenn Du daran denkst, beim nächsten Strategieprozess neue Ideen zu haben und wirklich diverse Gedanken zusammenzubringen, denke nicht unmittelbar an die „dicken Fische“: Ja, der Vorstand eines Wohlfahrtsverbands oder die Rektorin einer Uni machen Eindruck, liefern aber – aufgrund ihrer Rolle im System – nicht immer die wirklich inspirierenden Hinweise.
Hier macht es Sinn, breiter zu denken und neue „Köpfe“ einzubinden. Die sozialen Medien liefern hier spannende Einblicke… Und bedenkt abschließend bitte, dass eine Einladung nicht immer eine Einladung ist: Wenn der Chef zur Teilnahme einlädt (was vielleicht noch nie der Fall war), fällt es schwer, nicht zu erscheinen. Erst wenn eine „echte Einladungskultur“ etabliert ist, kann von echten Einladungen – die auch nicht angenommen werden müssen – gesprochen werden.
5. Agieren wir im Strategieprozess vornehmlich digital oder analog oder gar „hybrid“?
Ich bin kein Freund hybrider Veranstaltungen, das vorweg. Ich habe noch kein Setting erlebt, das auf Beteiligung, Mitdenken und -machen ausgerichtet ist und in der Verbindung von digital und analog funktioniert hat. Hybrid will ich aber nicht ausschließen. Hybrid im Kontext von Veranstaltungen, Workshops etc. ist für mich nicht das Verständnis von „sowohl, als auch“, sondern von „entweder, oder“. Dann wird ein Schuh draus: Machen wir Workshops, World Cafés und kreative Arbeit analog oder digital? Beides geht – getrennt voneinander und konsequent umgesetzt – wunderbar, das haben wir hoffentlich in den letzten beiden Jahren erfahren dürfen. Zusammen, also ein paar Menschen sind digital, ein paar analog beteiligt, geht nicht.
Die Vorteile digitaler Formaten liegen in der Möglichkeit, schnell mehr Personen einbinden zu können, das ist klar. Hinzu kommt aber noch die Frage, wie „synchron“ bzw. „asynchron“ die Beteiligung stattfindet: So ist die Einbindung externer (und interner) Teilnehmer*innen bspw. über die Nutzung von Online-Umfragen, bei denen selbstverständlich auch offene Antworten zu strategierelevanten Fragen gegeben werden können, einfach möglich (das Formulieren von guten Fragen ist wiederum ein eigenes Thema, da Fragen immer die Perspektive des Fragenden mit transportieren). Diesen Punkt zusammenfassend: Alles geht, nur nicht gleichzeitig.
Fazit
Die Beantwortung der Fragen allein führt natürlich noch nicht zu einem erfolgreichen Prozess. Ohne eine Klärung der Fragen kommt es aber im Verlauf immer wieder zu Problemen.
Somit: Nimm Dir die Zeit und kläre die wichtigen Aspekte vorab. Das entspannt den Gesamtprozess. Und zu dem wirst Du hier hoffentlich zeitnah weitere Infos finden.
Und natürlich gerne stehe ich Dir bei weiteren Fragen 😉 zur Verfügung.
Um keinen Beitrag mehr zu verpassen, kannst Du Dich auch gerne zum IdeeQuadrat-Newsletter anmelden. Dann gibt es regelmäßig neue Beiträge, Inhalte, Links, Tools etc… direkt in Dein Postfach!
New Work und Verwaltung: Warum die kommunalen Verwaltung eine Schlüsselrolle einnimmt, wenn es um New Work geht
Vor Kurzem habe ich mir den Spaß erlaubt, New Work und Verwaltung zusammen zu denken. Mehr noch: Ich habe behauptet, dass die kommunale Verwaltung einer der wesentlichen Player sei, wenn es um New Work ginge… Haha, lustige Reaktionen auf Twitter, verwunderte Gesichter im Rahmen des Kommunalcamps, bei dem ich die gleiche Behauptung in einer Session aufgestellt habe:
Aber ehrlich: Es war gar kein Spaß!
Ich meine das ernst. Wirklich!
Wirklich, wirklich!
Aber ich glaube, ich muss verschriftlichen, was ich mit meiner These meine. Denn es gab zwar Reaktionen auf den Tweet, aber niemand hat gefragt, was ich unter dem inzwischen wirklich strapazierten Flutschbegriff „New Work“ verstehe.
Also braucht es eine Definition von New Work. Daran anschließend sind die Herausforderungen der kommunalen Verwaltung kurz in den Blick zu nehmen, um zu einem neuen Verständnis der Rolle der kommunalen Verwaltung in der Entwicklung hin zu New Work zu kommen.
Was ist New Work?
Wer mir länger folgt, weiß, dass ich gerne zwischen a) New Work im Verständnis zeitgemäßer Organisationsentwicklung und b) New Work im Sinne Frithjof Bergmanns unterscheide.
Zu a) Unter New Work im Verständnis zeitgemäßer Organisationsentwicklung fällt aus meiner Sicht alles, was dazu dient, Organisationen anpassungsfähiger für kontinuierlichen Wandel zu machen. Die agilen Methoden, selbstorganisierten Strukturen und sinngetriebenen Ausrichtungen von Organisationen zählen dazu. Interessant ist, dass zeitgemäße Organisationsentwicklung bestehender Organisationen im Kern auf systemische Organisationsentwicklungstheorien aufbaut. Auch wenn es schwer fällt: Richtig neu ist das nicht. Unabhängig davon bleiben die Entwicklungen hin zu zeitgemäßen Organisationen aber aktueller denn je.
Zu b): Bergmann hingegen ging es in erster Linie nicht darum, hippe Organisationen zu designen, sondern die Gesellschaft zu verändern und ein anderes Lohnarbeitssystem zu schaffen, um damit den Herausforderungen unserer Zeit besser begegnen zu können.
Und die Herausforderungen sind vielfältig:
Klimakrise; digitale Transformation; massiver Fachkräftemangel in lebensrelevanten Branchen wie Gesundheit, Pflege und Erziehung; ein Bildungssystem, das auf allen Ebenen keine Chance hat, Zukunft zu gestalten, obwohl es für die Ausbildung der Kinder, Jugendlichen, jungen und älteren Erwachsenen zuständig sein sollte; eine globale Krise der (industriellen) Landwirtschaft, Urbanisierungstendenzen, die auch von einer Pandemie nicht gebrochen werden konnten und so weiter und so fort…
Bergmanns Idee zur Bewältigung der Herausforderungen lautet (sehr kurz) zusammengefasst:
Selber machen!
New Work heißt selber machen
Über High-Tech-Selbstversorgung muss es zukünftig darum gehen, materielle Dinge selbst zu reparieren und/oder via 3D-Druck in lokalen communities, in maker- und coworking-spaces neu zu gestalten. Dadurch spart man Material, Kosten und CO2.
Aber auch bei immateriellen Dingen wie der Gestaltung von Pflege und Betreuung können wir angesichts hundertausender fehlender Fachkräfte nicht mehr auf „Institutionen“ oder „den Staat“ warten.
Auch hier geht es darum, Netzwerke zu kreieren – caring communities, die lokal und kleinräumig und vor allem autonom und selbstbestimmt agieren.
Im Bildungssektor sind wir hier schon weiter, oder wer wartet noch darauf, dass klassische Institution der formalen Bildung vor Ort das gerade genau passende Angebot zur richtigen Zeit bereit stellen? Besser ist: Im Netz schauen, learning communities gestalten, einen WOL circle ins Leben rufen und los lernen – New Learning leben und – eben – selber machen.
Bei New Work geht es nicht darum, was ich „wirklich, wirklich tun will“
Um die Netzwerke und communities gestalten zu können, ist es jedoch notwendig – so Bergmann – sich mit sich selbst befasst zu haben. In meinen Augen liegt hier einer der Denkfehler der „New Work Community“:
Es geht nicht darum, was ich „wirklich, wirklich tun will“. So hat das, „was ich wirklich, wirklich tun will“, aus Perspektive Bergmanns wenig mit „Selbstfindung“ im klassischen Sinne zu tun:
Mir geht es um grundlegende Dinge, darum, dass Menschen sich nicht in Lohnarbeit, zu der sie keinen inneren Bezug haben, erschöpfen und am Lebensende feststellen, dass sie gar nicht richtig gelebt haben.
Interview mit Bergmann, 2017
Es ging Bergmann nicht darum, dass jeder egozentriert nackig im Wald sitzt und sein „Why“, seinen persönlichen „purpose“ oder whatever findet, auch wenn dieser in hippen Großstadtcafés gerne gesucht wird.
Vielmehr geht es bei dem, was man „wirklich, wirklich tun will“ darum, über die Auseinandersetzung mit sich selbst in die Lage versetzt zu werden, im Sinne der oben genannten Beispiele gestalterisch tätig zu sein. Arbeit wird damit zu etwas, was Menschen im Innersten stärkt, anstatt schwächt.
Erst dann, wenn ich die gesellschaftlichen Bedarfe sehe und meinen Anteil an der Gestaltung dieser Bedarfe erkenne, kann ich sinnvoll zu Gestaltung der Gesellschaft beitragen, indem ich das tue „was ich wirklich, wirklich tun will“.
Ich kann mich in privaten caring communities engagieren, maker spaces gründen, Politik für eine Gesellschaft der Zukunft machen, Kinder betreuen, mich selbständig machen, start-ups gründen, mir einen neuen Job suchen, Blogbeiträge schreiben, (m)einem „calling“ folgen…
Mit anderen Worten: Die Suche nach dem, was man wirklich wirklich tun will, allein reicht und hilft nicht. Es geht darum, Gesellschaft zu gestalten.
Dazu noch einmal Bergmann selbst:
Es gibt Alternativen zu diesem Lohnarbeitssystem, dem wir uns die letzten 200 Jahre unterworfen haben und das von uns verlangt, dass wir als Gegenleistung für die Existenzsicherung einen monotonen Job verrichten. Statt Grossunternehmen, in denen die Bürokratie und die Angst regieren, brauchen wir vermehrt kleine kooperative Organisationen, in denen Menschen wirklich etwas voranbringen wollen.
Interview mit Bergmann, 2017
Soziale Innovationen ermöglichen, oder: New Work und Verwaltung
Und genau hier ergibt sich die Kreuzung der kommunalen Verwaltung mit dem Grundkonzept von „New Work“, wie ich es oben geschildert habe.
Im von mir hier postulierten Sinne geht es bei New Work nicht um die Arbeit in der kommunalen Verwaltung als Organisation. Es geht um die Arbeit an der Kommune. Oder noch größer: Bei New Work geht es darum, Gesellschaft zu gestalten. Und dazu braucht es Bedingungen, die dies ermöglichen.
Es braucht Initiativen, Unterstützung, Kompetenz und Raum, damit Menschen zusammen kommen können. Das Zusammenkommen dient dazu, gemeinsam, spontan und ungeplant neue Ideen und vor allem die Umsetzung neuer Ideen zu gestalten.
Das ist dann die oft beschworene, viel gesuchte und selten konkret gewordene soziale Innovation.
Raum ist wesentlich
Insbesondere der Raum ist wesentlich (und gut gestaltbar): Gerade nach der Pandemie (aber auch schon vorher) haben es Kommunen mit zunehmend leer stehenden und unattraktiven Innenstädten zu tun. Leider hat der Einzelhandel in vielen Fällen den Entwicklungen nicht standhalten können (und nein, es waren nicht die Entwicklungen der letzten zwei, sondern locker die Entwicklungen der letzten 15 Jahre, in denen die digitale Transformation im Einzelhandel verpennt wurde).
Hier kann die Kommune mit der Anmietung und Neugestaltung von Raum, der für die Gemeinde zur Verfügung gestellt wird, punkten. Coworking-Spaces brauchen in kleinen Gemeinden kommunalen Support, um überleben zu können, bringen aber enorm viel für die Gemeinde, wie Tobias Kremkau hier eindrücklich ausführt.
Und die handwerklich mehr als begabten Profis des Bauhofs können den Makerspace in einer leerstehenden Fabrikhalle nicht nur ausstatten, sondern auch inhaltlich betreuen. In diesen Maker-Spaces können dann Rentner*innen ihre Erfahrungen in alten Handwerken und Kulturtechniken an junge Menschen weitergeben (bspw. Mofa reparieren) und junge Menschen können die Skills hinsichtlich digitaler Angebote an Unerfahrene weitergeben (etwas plakativ, I know).
Neben agilen Bauhöfen (sowas gibt es wirklich) zur Betreibung der Maker-Spaces habe ich die Volkshochschulen im Kopf, die in den meisten Fällen zumindest ein kommunale Anbindung haben. Diese, oftmals sehr breit aufgestellten Organisationen haben über ihre Programme Verbindungen in alle Bevölkerungsteile und Generationen. Deutlich wird jedoch, dass VHS-Programme im klassischen Sinne zukünftig kaum noch tragfähig sind. Hier wäre ein Engagement in der Gestaltung der Kommune, bspw. als Betreiber der Coworking-Spaces mehr als sinnvoll denkbar. Darüber hinaus gewinnt „Neues Lernen“ in allen Richtungen an Bedeutung. Hier – im Rahmen von New Learning – könnten wiederum die VHS eine tragende Rolle spielen. Und Leuchttürme wie Oodi in Helsinki zeigen den Weg.
Aus der Gemeinde denken
Wichtig bei all diesen Überlegungen ist aber, dass Verwaltung nicht neue Programme aufsetzt, die die Gemeinde aus der Perspektive der Verwaltung neu gestalten.
Vielmehr ist ein Perspektivenwechsel notwendig – von den Bedarfen der Verwaltung hin zu den Bedarfen der Menschen. Es geht um Kundenorientierung in der Verwaltung, wenn man dieses Wort nutzen will.
Somit stehen vor der Anschaffung des 3D-Druckers für den Makerspace breite Beteiligungsprozesse, die in Workshop-Formaten die Bedarfe und Herausforderungen der Menschen in der Gemeinde in den Blick nehmen:
- Was braucht die Gemeinde?
- Was brauchen die Menschen in der Gemeinde?
- Was gibt es schon?
- Was kann unterstützt werden?
Entsprechende Formate und Prozesse sind nicht neu. Von World-Cafés über Design Thinking Prozesse auf kommunaler Ebene bis hin zur Veranstaltung von Barcamps, die explizit die kommunalen Belange in den Blick nehmen gibt es Formate, die genau die Anliegen der Beteiligung und Gemeindeentwicklung im Blick haben.
Neu ist jedoch, dass die kommunale Verwaltung diese Formate und Prozesse aktiv gestaltet und im Sinne einer lebenswerten Gemeinde vorantreibt und darüber aktiv gestaltend tätig wird.
Und selbst das ist nicht ganz neu: Die hier skizzierten Ideen sind an vielen Orten bereits Realität. So lohnt es beispielsweise, einmal bei Frederik Fischer zu den Themen rund um KoDorf und Coworking auf dem Land vorbeizuschauen, dessen Projekte ohne kommunale Unterstützung nicht stattfinden könnten.
New Work in der Verwaltung, oder: Was wird gebraucht?
Klingt alles gut, oder? Aber wie kann es konkret gelingen, die kommunale Verwaltung „on the way to new work“ zu bringen?
Aus meiner Sicht bedingen sich die Entwicklung der Gemeinde und die Entwicklung der kommunalen Verwaltung als Organisation. Hier kommen wir zu der Definition von New Work im Sinne der Organisationsentwicklung.
Im Rahmen dieses Beitrags ist es nicht möglich, alle Optionen der Organisationsentwicklung hin zu einer neuen Arbeitswelt darzulegen. Die grobe Orientierung an der Dreiteilung von Menschen (Haltungen, Kompetenzen…), Teams (Wie wollen wir zusammen arbeiten?) und der Organisation (Welche Strategien und Strukturen sind sinnvoll, um einen möglichst großen Mehrwert für die Nutzer*innen zu generieren?) zeigt schon auf, dass das Thema Organisationsentwicklung in diesem Kontext enorm komplex ist.
Hinweisen will ich nur darauf, dass gerade in traditionellen Organisationen (zu denen Verwaltungen zweifelsohne zu rechnen sind) oft eine technokratische Vorstellung auch der Art vorherrscht, wie Veränderung angegangen werden sollte. Klassische (und ehrlich gesagt gruselige) Vorstellungen von Change Management im Sinne von unfreezing – changing – refreezing sind vorherrschend.
Im Zuge kontinuierlichen Wandels jedoch macht das keinen Sinn. Ein zeitlicher Ablauf, der darlegen soll, was wann wie genau nacheinander passieren muss, ist (und war schon immer) hinfällig. Rezepte für komplexe Fragestellungen funktionieren nicht. Nicht umgesetzte Rezepte führen vielmehr dazu, dass Entwicklung nicht passiert:
„Weil Schritt 1 von X nicht passiert ist, weil sich Abteilung XY nicht bewegt hat und überhaupt nicht digital genug ist, weil der Hans nicht das richtige Mindset hat, nicht richtig tickt und sowieso nicht alle Tassen im Schrank hat, konnten wir ja auch nicht so weitermachen, wie geplant und deswegen konnten wir dann auch noch keine Beteiligungsprozesse anstossen und überhaupt, Corona!“
Kurz: Verzichtet also auf Rezepte! Versucht vielmehr, auf vielen Ebenen viele kleine, strukturelle Schritte konkreter Veränderung anzustoßen. Iterative Organisationsentwicklung ist hier das Stichwort. Fragen dazu sind:
- Was ist eine Herausforderung, eine Spannung? Was wollen wir konkret ändern?
- Wie lautet eine Hypothese dazu? Wenn wir XY anders machen, erwarten wir, das Z passiert!
- Was kann mein Team machen, um die Hypothese zu testen?
- Und: Was kann ich heute und morgen anders machen, um die Hypothese zu testen?
- reflektiert Euch: Führt regelmäßige Retrospektiven zur Hypothese durch!
Und schon allein die Änderung der Durchführung der Meetings im Team kann Wunder bewirken. Man kann mit einer stillen Minute zum Einstieg beginnen, Check-In Fragen nutzen, Meetings im Stehen abhalten, die Moderation wechseln lassen, kein Protokoll mehr anfertigen, sondern ein Fotoprotokoll nutzen oder – als einfachste Intervention – sich nicht immer auf den gleichen Platz setzen.
Wenn Du Dich dahin setzt, wo normalerweise die Teamleitung sitzt, wird das Auswirkungen haben. Kleine zwar, aber immerhin.
Alternativ dazu:
Wo sammelt ihr im Team die Dinge, die verändert werden sollten oder müssen? Nutzt ihr ein Team-Board oder ähnliches, um den Fortschritt von angestoßenen Projekten zu visualisieren? Dann braucht ihr auch kein Protokoll mehr…
Und so weiter, und so fort… Hinweise dazu, was alles anders gemacht werden kann, findest Du zum Beispiel im Buch „New Work Hacks“.
Gebraucht wird also Mut, kleine Schritte zu gehen und Dinge selbst anders zu machen. Nutze den Einfluss, den Du hast, um neue Wege zu gehen.
Nicht jetzt alles!
Es geht nicht darum, von jetzt auf gleich den kompletten Verwaltungsapparat zu drehen. Das wird nicht gelingen, die Mühe lohnt nicht. Genausowenig lassen stete, kleine Veränderungen selbst den steifsten Beamten kalt. Steter Tropfen höhlt den Stein. Lasst es tropfen. Macht Dinge anders, selbst.
Daraus, aus dem „selbst machen“ erwächst die Kultur der Organisation, nach und nach. Und mit dem Selbst machen sind wir wieder bei der Grundidee von Bergmann:
Wir müssen die Veränderungen, die wir wünschen, selbst in die Hand nehmen.
New Work und Verwaltung? Kein Scheiß!
Kein Scheiß?
Ja, sorry für den Ausdruck, aber vor einigen Jahren habe ich unter dem Titel „New Work zwischen Spiritualität, elitärem Scheiß und dringender Notwendigkeit“ einen Beitrag veröffentlicht.
Damals schon ging es um den Begriff „New Work“ und um das, was aus dem Begriff geworden ist, was darunter verstanden wird (und um die Frage, wie teuer ein Tag auf einer hippen Veranstaltung eigentlich sein kann…).
Für mich gab es eine Dreiteilung zwischen Spiritualität, dringender Notwendigkeit und elitärem Scheiß.
Unter der Spiritualität habe ich die Konzepte gefasst, die New Work vor allem am „Mindset“ festmachen aka „Wir müssen nur die Menschen ändern, dann läuft das schon mit diesem New Work!“
Unter elitärem Scheiß habe ich die Diskussionen um Organisationen gefasst, die New Work verstehen als „hippes, auf jeden Fall digitales Arbeiten“ in irgendwelchen Agenturen und den Besuch von völlig überteuerten Veranstaltungen, auf denen selbst Manager weiße Turnschuhe tragen (und geduzt werden müssen, bitte).
Unter „New Work als dringende Notwendigkeit“ jedoch verstehe ich die dringend notwendige Idee einer Neuen Arbeit dort, wo sie wirklich, wirklich gebraucht wird.
New Work, als Arbeit, die den Menschen stärkt, muss gerade die Menschen stärken, die einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und dazu gehören eben auch die Menschen in der kommunalen Verwaltung.
New Work und kommunale Verwaltung ist damit kein elitärer Scheiß, sondern dringende Notwendigkeit 😉
Und jetzt los!
6 Thesen zur Zukunft Sozialer Arbeit
Einen Vortrag über die Zukunft einer Branche, zur Zukunft Sozialer Arbeit, zu halten, mitten in einer hoffentlich irregulären Zeitphase, mitten in einer Pandemie, ist ziemlich wagemutig.
Wir haben in den letzten anderthalb Jahren zwar gelernt, was unter der VUCA-Welt zu verstehen ist. Wir haben gelernt, was Komplexität bedeutet. Wir haben gelernt, dass Digitalisierung auch in der Sozialwirtschaft auf unterschiedlichen Ebenen angekommen ist – oder zumindest nicht mehr als völlig absurd abgestempelt wird 😉
Wir haben gelernt, dass es anders kommen kann als geplant. All dies und noch viel mehr haben wir gelernt.
Aber wir lernen in der Regel aus den Erfahrungen der Vergangenheit, vielleicht aus der Gegenwart. Aber ein Lernen aus der Zukunft, die ja bekanntlich vor uns liegt, ist entsprechend schwierig.
Ich will aber trotzdem versuchen, ein paar Aspekte aufzugreifen, die die Zukunft der Sozialen Arbeit vielleicht ausmachen könnten.
In einigen Jahren können wir dann alle Wetten abschließen und uns noch einmal anschauen, was geblieben ist, was richtig, und was auch kompletter Blödsinn war.
Bevor ich euch meine Thesen – es sind dann doch mehr als drei Thesen geworden – für die Zukunft zeige, zwei Prämissen vorab:
Als erstes bitte ich euch, die internationale Definition der Sozialen Arbeit im Hinterkopf zu haben.
Je länger ich mich mit dieser Definition sozialer Arbeit befasse, die ihr bspw. beim DBSH auf der Homepage findet, umso besser gefällt sie mir. In dieser Definition steht, dass
„Soziale Arbeit gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen fördert. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. (….) Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein.“
Definition Soziale Arbeit DBSH
Mir gefällt die Definition so gut, weil sie zum einen Soziale Arbeit als gesellschaftliche Veränderungen befördernd ansieht. Die Definition gibt der Sozialen Arbeit also eine sehr aktive Rolle in der Gestaltung gesellschaftlicher Veränderungen.
Soziale Arbeit ist damit immer noch – und in meinen Augen in der Zukunft noch mehr – auch politische Arbeit. Zum anderen geht es auf individueller Ebene um die Förderung von Selbstbestimmung und Autonomie.
Das gibt eine sehr klare Vision vor, worauf die Arbeit mit Menschen zielen soll – egal ob Kita, Kindergarten, Jugendhilfe oder Altenhilfe. Und eine leitende Vision ist in Zeiten des Umbruchs enorm relevant, um Orientierung zu bieten.
Und mehr noch: Selbstbestimmung und Autonomie lässt sich auch wunderbar auf den Sozialraum, die Gemeinde, das Quartier übertragen. Und Selbstbestimmung und Autonomie ist nicht irgendwann abgeschlossen, sie bleibt Daueraufgabe und ist damit zukunftsorientiert.
Für mich und vielleicht auch für Euch bietet diese Definition einen Fixpunkt, an dem sich gut orientieren lässt, wohin es in der Zukunft gehen kann, denn auch die gesellschaftlichen Veränderungen sind nie abgeschlossen.
Es geht damit um die Gestaltung eines Prozesses, wie unsere Zukunft aussehen kann/könnte.
Nach der Definition, die ihr bitte im Hinterkopf behaltet, seht ihr gleich, dass ich meine Thesen als Heuristiken gestaltet habe. Gerd Gigerenzer definiert Heuristik als Strategie, die mit nur wenigen Informationen arbeitet und den Rest ignoriert. Ihr kennt das vielleicht aus dem agilen Manifest, in dem der eine Wert mehr als der andere zählt, aber beide wichtig sind.
Damit versuche ich, die hinter den jeweiligen Aussagen liegende Komplexität des Systems, über das wir reden, halbwegs im Griff zu behalten.
So hat jede und jeder von Euch eigene Erfahrungen und eigene Vorstellungen von dem, was Soziale Arbeit ist und ausmacht. Allein die Tatsache, dass in unserer Branche mehrere Millionen Menschen arbeiten, zeigt, wie komplex das System ist.
Hinzu kommt, dass unsere Organisationen abhängig sind von anderen Funktionssystemen, die in ihrer Systemlogik diametral entgegengesetzt zu unserer Branche funktionieren.
So sind wir auf die Gestaltung von Dynamik und Komplexität angewiesen – oder was ist komplexer als eine Gruppe Kindergartenkinder?
Hingegen sind die Kostenträger – egal ob Kommunen, Kassen… – an Überprüfbarkeit, Regelkonformität und der Einhaltung von Vorgaben interessiert. Das macht es doppelt schwer, gestalterisch tätig zu werden.
Damit aber genug der Vorrede, auf in die Thesen:
These 1: Agieren und die Zukunft agil gestalten ist wertvoller als abwarten und reagieren

Auf den ersten Blick klingt diese These trivial, oder? Aber ich bin ziemlich fest von dem überzeugt, was Alan Kay in dem Zitat hier aussagt:
„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“
Aufgrund der Pandemie, aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen, aufgrund anstehender politischer Veränderungen und auch aufgrund der sich durch die Digitalisierung verändernde Konkurrenzsituation werden soziale Einrichtungen, Organisationen, Wohlfahrtsverbände und jede und jeder einzelne verstärkt gefordert, Zukunft aktiv zu gestalten.
Es wird nicht mehr ausreichen, in die nächste Leistungsvereinbarung zu gehen und zu hoffen, dass am Ende genauso viel herauskommt wie in der Vergangenheit.
Zur aktiven Gestaltung stellt sich die Frage, in welcher Ausrichtung aktiv gestaltet werden soll. Hier bin ich davon überzeugt, dass der Fokus noch stärker als bisher auf der Wertschöpfung der Organisation – also der Frage danach, wie die geleistete Arbeit in der Einrichtung zu höherem Wert – für die Klient*innen, die Quartiere, die Familien – liegen wird.
Das ist der wesentliche Fokus der Organisationen.
Dazu wiederum brauchen Soziale Einrichtungen Strategien. Diese Aussage allein ist schon wichtig, da ich immer wieder Organisationen sehe, die keine Strategie haben. Wichtig bei der Strategie ist aber nicht nur die Entwicklung, sondern vor allem die agile Umsetzung der Strategie. Agile Strategieumsetzung verstehe ich im Sinne einer möglichst hohen Anpassungsfähigkeit mit einem klaren Fokus auf die Nutzer*innen der Organisation.
Es wird in Zukunft wesentlich stärker darum gehen, die Wertschöpfung der eigenen Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen.
Und – wie gesagt – die Wertschöpfung sind nicht Nebenkriegsschauplätze wie – als ein Beispiel – die Frage, ob Menschen im Büro, also wieder in Präsenz, oder remote arbeiten dürfen. Diese Frage interessiert die Klientin, die Nutzerin, den Kunden nicht. Und ja, mir ist bewusst, dass diese Kundenfrage bei uns etwas komplexer ist, mit Kostenträgern, Krankenkassen und Kommunen als Finanzierer sozialer Arbeit.
Aber gerade mit Blick auf diese sollte immer klar sein, warum wir was wie für unsere Nutzer*innen leisten.
These 2: Sich auf das eigene Können, die eigenen „Wurzeln“ besinnen ist wertvoller als methodischen „Moden“ nachzujagen!

Wenn es – wie ich es in These 1 postuliert habe – zunehmend wichtiger wird, Zukunft aktiv und mit Strategien zu bestreiten, die auf die Kund*innen, die Nutzer*innen zugeschnitten sind, braucht es eine Orientierung, woran die eigene Arbeit methodisch ausgerichtet werden kann.
Ich habe mich in den letzten Jahren stark damit befasst, angeblich als „neu“ titulierte Management-Methoden auf soziale Organisationen zu übertragen bzw. die Verbindungen zwischen den Methoden und der Realität in sozialen Organisationen herzustellen. Agile Management-Methoden sind natürlich ein wesentliches Stichwort.
Kanban, Scrum, Design Thinking oder Effectuation sind Methoden, die zu mehr Innovation, mehr Anpassungsfähigkeit und zu einer neuen Art von Arbeit führen sollen. Viele dieser Ansätze sind auch in der Sozialen Arbeit mehr als sinnvoll zu adaptieren. Eine Auseinandersetzung mit diesen lohnt sich wirklich.
Aber mein Plädoyer für These 2 ist, erst im eigenen Werkzeugkoffer zu schauen und die Methoden, Tools und Werkzeuge, die soziale Berufe qua ihrer Ausbildung und ihres Studiums im Koffer haben, wirklich zu verstehen und zu nutzen.
So liegt der Kern agilen Arbeitens bei all den genannten Methoden für mich in drei Punkten:
- Enge Zusammenarbeit in (möglichst interdisziplinären) Teams, die für ihre Arbeit Verantwortung tragen (Kollaborieren)
- In kurzen Iterationen Ergebnisse zu erzielen (Liefern)
- Und in regelmäßigen Reflexionen der Iterationen, wozu die Anpassung, Entwicklung, Verbesserung gehört (Reflektieren)
All diese Aspekte sind jedoch Standard sozialer Arbeit – egal ob mit Menschen, Gruppen oder im Gemeinwesen.
Jedes Hilfeplangespräch in der Jugendhilfe ebenso wie jede Intervention in der Beratung basiert genau darauf, das Problem zu erfassen, Hypothesen zu bilden, diese zu testen, dann gemeinsam zu reflektieren und neue Hypothesen zu bilden. Niemand setzt in der Sozialen Arbeit vorab ein Ziel wie in der Wasserfall-Logik: „Der Jugendliche XY muss im Jahr 2027 Rechtsanwalt sein, bitteschön.“ Das ist Nonsens.
In der Sozialen Arbeit – und damit wären wir wieder bei der eingangs genannten Definition – geht es um die Begleitung hin zu Selbstbestimmung und Autonomie. Das ist alles andere als statisch, sondern eine klassische Vision.
Ich warne nur davor, Methoden Sozialer Arbeit – wie bspw. das Empowerment – zu verstehen als „jeder kann machen was er will“.
Ich will Intuition und Gefühl in der Sozialen Arbeit überhaupt nicht in Abrede stellen, im Gegenteil, aber die Herangehensweise „Intuitiv habe ich im Gefühl, dass es bestimmt richtig und gut sein könnte, was ich mache!“ führt zu Gewurschtel und Chaos.
Zum einen – und das ist der wesentliche Fokus – mit Blick auf unsere Nutzer*innen müssen wir professionelle Entscheidungen auf Daten basieren lassen. Diese Daten lassen sich gewinnen, indem man regelmäßig Fortschritte auswertet – die Retrospektiven im agilen Management.
Zum anderen werden wir die Daten aber auch in der Rechtfertigung unserer Leistungen gegenüber den Kostenträgern brauchen. Gegenüber Kommunen und Krankenkassen zu argumentieren, dass diese oder jene Intervention bestimmt irgendwie vielleicht wirkt, wird in Zukunft nicht dazu führen, eine ausreichende Finanzierung seiner Arbeit zu bekommen.
Hier sehe ich, das nur als kleiner Exkurs, ein wesentliches Disruptionspotential:
Wenn es anderen Playern, die neu in den Sozialmarkt eindringen, gelingt, besser und datenbasiert zu argumentieren, warum welche Leistung wie benötigt wird, lässt sich darüber enormes Geld sparen. Dass diese Anbieter von den Kostenträgern bevorzugt werden, ist dann nicht verwunderlich.
These 3: Unbedingt systemisch denken ist wertvoller als Denken in vereinfachenden Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen.

Unter These 2 habe ich versucht, zu argumentieren, dass agiles Denken und Handeln den Methoden Sozialer Arbeit inhärent ist. Der Sozialen Arbeit ebenfalls inhärent ist der Kern von These 3:
Der Fokus Sozialer Arbeit ist immer das soziale System. Entsprechend komplex ist die Ausbildung für soziale Arbeit: Soziologische Aspekte werden ergänzt um medizinische und psychologische Aspekte. Hinzu kommen eigene disziplinäre Anteile ebenso wie Erfahrungswissen aus der sozialen Arbeit heraus. In der Sozialen Arbeit geht es um Ganzheitlichkeit.
Nicht der Fokus auf die Psyche oder auf den Körper, das Medizinische, zählt, sondern der Fokus auf das System, in dem Menschen agieren.
Systemdenken ist somit Kern sozialer Arbeit.
Systemdenken ist immer dann sinnvoll, wenn komplexe, mehrstufige, vielfältige und dynamische Strukturen in den Blick genommen werden. Wir sollten gelernt haben, dass die Veränderung sozialer Systeme darin besteht, Impulse in die Systeme zu senden und zu hoffen, dass die hypothesengeleitete, gewünschte Veränderung eintritt.
Der Blick in unsere Umwelt, in Funktionssysteme, von denen Soziale Arbeit abhängig ist, zeigt jedoch, dass das Denken in Kausalitäten, in „wenn – dann“ Beziehungen und damit in Abhängigkeiten Überhand gewinnt. Ich nehme wieder die schon in der vorherigen These angesprochene Wirkungsmessung, um zu verdeutlichen, was ich meine:
Wir sehen uns in den nächsten Jahren einer deutlich angespannteren Finanzlage der Kostenträger gegenüber. Entsprechend zurückhaltend werden die Kostenträger sein, Gelder für soziale Leistungen auszugeben. Das Klatschen für die angeblich so relevanten Branchen ist da nur noch zynische Hintergrundmusik.
Vielmehr geht es um den Nachweis, dass die Investition entsprechende Wirkung entfaltet. Kurz: Wenn auf Seite A Geld reingesteckt wird, wird erwartet, dass bei B entsprechende Ergebnisse sichtbar werden. Wenn keine Wirkung nachweisbar ist, werden Gelder gekürzt.
Gegen diese einseitigen Tendenzen gilt es zukünftig verstärkt gegenzuhalten.
Es gilt, deutlich zu machen, dass sich soziale Systeme – dazu gehören übrigens auch soziale Organisationen – nicht kausal, nicht technokratisch, nicht regelgeleitet verändern lassen. Damit spreche ich nicht gegen die Wirkungsmessung sozialer Arbeit, im Gegenteil:
Wir sind aufgefordert, zukünftig viel stärker unsere eigene Professionalität zu betonen und über diese Professionalität, zu der das Systemdenken zwingend gehört, die Wirkung sozialer Arbeit darzulegen.
Der Bezug zur Definition Sozialer Arbeit zeigt die Komplexität und die Notwendigkeit, in Systemen zu denken, indem nicht nur ein Funktionssystem angesprochen wird, sondern auf Ebene der Menschen, der Gruppen, der Organisation und der Gesellschaft Veränderung hin zu Autonomie und Selbstbestimmung gefordert und durch Soziale Arbeit gefördert wird. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage Sozialer Arbeit.
Einfaches Denken und Handeln in Ursache – Wirkungsbeziehungen greift da schon jetzt und zukünftig verstärkt zu kurz.
These 4: Den Sinn sozialer Arbeit an der Lebensrelevanz für die Klienten festmachen ist wertvoller als ihn an den vermeintlichen Bedarfen des gesellschaftlichen Systems auszurichten.

Den Begriff der Lebensrelevanz habe ich in einem Podcast mit Hartmut Rosa gehört.
Hartmut Rosa erläutert, dass wir in der Pandemie die Lebensrelevanz vor die Systemrelevanz gesetzt haben. Konkret spricht er davon, dass wir uns als Gesellschaft dazu entschieden haben, den Wert des Lebens vor die Notwendigkeiten des Systems zu stellen. Gesundheitsschutz geht vor Wirtschaft.
Natürlich gibt es hier auch einige Stimmen, die in Teilen berechtigt die Wichtigkeit der Wirtschaft betonen, aber der wesentliche Teil der Bevölkerung hat verstanden, dass Leben, egal welches, unbezahlbar ist.
Für mich folgt daraus, dass es uns im Sozialen wieder gelingen muss, die Lebensrelevanz unserer Berufe, unserer Branche zu betonen. Wir leisten mehr als das Ruhighalten der Gesellschaft. Und daraus folgt, dass Soziale Arbeit politisch ist und bleibt – vielleicht mehr noch als in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Gerade angesichts der Bundestageswahl finde ich es auf der einen Seite mehr als relevant, die Programme der zur Wahl stehenden Parteien dahingehend zu analysieren, ob und wie das Soziale berücksichtigt wird. Da gibt es einige Unterschiede. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ein „Weiter so“ für mich ein No Go wäre:
Hier brauchen wir einen zeitgemäßen, zukunftsgerichteten Neuanfang.
Auf der anderen Seite plädiere ich dafür, egal wie die Wahlen ausgehen, die politische Verantwortung der Sozialen Arbeit wahrzunehmen. Es ist notwendig, für seine Interessen, vor allem aber für die Interessen der Menschen einzustehen, für die wir da sind.
Und gerade die marginalisierten Gruppen von Menschen brauchen unsere Unterstützung.
Das ist einerseits die Aufgabe von jeder und jedem im sozialen Sektor. Für mich ist es aber insbesondere eine Führungsaufgabe, da politische Arbeit im Sozialwesen Interessenvertretung und damit Lobbyarbeit ist, auf lokaler, kommunaler und überregionaler Ebene.
These 5: Digitale Chancen nutzen und „normal“ werden lassen ist wertvoller als die bequeme Rückkehr zum Gewohnten

Bislang bin ich eher allgemein geblieben. Agieren mehr als Reagieren, die eigenen Wurzeln mehr als neue Moden, Systemdenken mehr als kausale Zusammenhänge und auch Lebensrelevanz mehr als Systemrelevanz betonen das große Ganze, auch wenn hieraus natürlich sehr konkrete Handlungen abzuleiten sind. Lasst uns aber jetzt ein wenig tiefer gehen und über Digitalisierung sprechen.
Wir haben in den letzten 18 Monaten von zu Hause gearbeitet, remote Prozesse sozialer Arbeit gestaltet und auch im Sozialwesen erspürt, was es mit dieser Digitalisierung so auf sich haben könnte.
Aber mal ehrlich:
In weiten Teilen haben wir auf eine Krise reagiert, auch wenn das – so mein Eindruck – in vielen sozialen Organisationen wirklich gut gelungen ist. Das, was oft passiert ist, war Krisenmanagement.
Programme, Angebote und Strategien zum Umgang mit einer Pandemie wurden aus dem Boden gestampft. Da war das mit den digitalen Tools und Möglichkeiten hilfreich. Aber das war und ist noch längst nicht das, was die digitalen Möglichkeiten bieten. Eher sogar im Gegenteil.
So höre ich immer wieder die Aussage, dass „Videokonferenzen nun wirklich nicht vermisst“ wurden oder die „Veranstaltung Gott sei Dank wieder in Präsenz“ stattfinden kann oder oder oder… Der Wunsch, wieder in die „Normalität“ zurückzukehren ist nicht nur ungebrochen, sondern hat sich natürlich in den letzten Monaten verstärkt.
Wer will nicht „Normalität“ nach 18 Monaten Pandemie?
Aber wir haben – so Sascha Lobo – „jetzt einen Slot, in dem Menschen eine große Einsicht entwickelt haben in die Notwendigkeit der Instrumente der digitalen Vernetzung.“
Und auch im Sozialwesen haben wir diesen Slot jetzt.
Aber auch Lobo warnt davor, dass die Einsicht in notwendige Veränderungen nachlässt, sobald der Druck nachlässt, verändern zu müssen.
Daraus folgt, dass es die Aufgabe von Euch, von den „digitalen Vorreiter*innen“ in sozialen Organisationen ist, jetzt – solange das Möglichkeitsfenster noch offen ist – Prozesse und Strukturen zu gestalten, die ein „wieder zurück zur Normalität“ verhindern und eine digital vernetzte, kreative, kollaborative, auf CoCreation setzende neue Normalität schaffen.
Dazu sind Widerstände zu überwinden, denn das alte System ist bekannt, das neue aber erst in wenigen Ansätzen erkennbar.
These 6: Lernerfahrungen in verunsichernden Prozessen machen ist wertvoller als die oft illusorische Ausrichtung an perfekten Projektergebnissen.
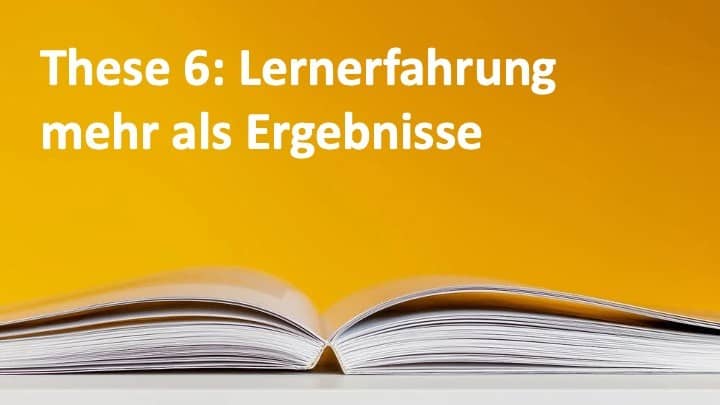
Die geschilderten Herausforderungen neuer Wege in der Gestaltung von Arbeit, von Organisationen und digital vernetzter Arbeit erzeugen ein Gefühl der Unsicherheit. Das Gefühl der Unsicherheit jedoch, ist nie angenehm. Menschen streben immer nach Stabilität und dem Altbekannten. Sie tun das, um Energie zu sparen.
In Organisationen ist das genauso. Neue Wege, Veränderungen und Innovationen in Organisationen sind störend. Und damit ergibt sich ein Dilemma, denn jedem ist bewusst, dass sich Dinge ändern müssen, um voranzukommen. Hier setzt These 6 an:
Wenn es gelingt, nicht mehr die perfekten Ergebnisse, die Resultate am Ende eines Projekts in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die gemachten Lernerfahrungen, wird es einfacher, mit der Unsicherheit umzugehen.
Es wurde schon in den letzten Monaten und Jahren viel von der experimentellen oder auch agilen Haltung gesprochen. Experimente machen und früh Scheitern war das Credo. Da wird jede*r Geschäftsführung Angst und Bange, denn wer will schon scheitern?
Aber lernen wollen wir alle. Und dieser Switch, dieser Wechsel wird zukünftig vermehrt Bedeutung haben:
Lernerfahrungen müssen in den Vordergrund rücken.
Es muss in der Arbeit vermehrt darum gehen, sich auf den Weg zu begeben, zu lernen und den Weg auf Basis der Lernerfahrungen weiterzugehen. Das ist gar nicht so schwierig, setzt aber die Disziplin voraus, sich an bestimmte Prozesse, vor allem Lern- und Reflexionsprozesse zu halten. Da können wir in sozialen Berufen noch deutlich besser werden.
Fazit zur Zukunft sozialer Arbeit: Radikal auf dem Weg in eine Kultur sozialer Digitalität

Zur Wiederholung noch einmal meine Thesen für eine Zukunft der Sozialen Arbeit:
These 1: Agieren mehr als Reagieren
These 2: Die eigenen Wurzeln mehr als neue Moden (besser These 1???)
These 3: Systemdenken mehr als kausale Zusammenhänge
These 4: Lebensrelevanz mehr als Systemrelevanz (besser These 2)
These 5: Digital anfangen mehr als aufhören!
These 6: Lernerfahrung mehr als Ergebnisse
Ich will meinen Vortrag mit einem Zitat von Erich Fromm beenden.
Erich Fromm sagt, dass
„Die Wahrheit (…) nicht nur bedeutsam und ganz sein [muss], sie muss auch radikal sein, nicht geschönt, gesüßt, mit Zuckerguß überzogen. Die Erfahrung zeigt, dass die Wahrheit, das heißt die Konfrontation mit der Wirklichkeit, dort eine besondere Wirkung hat, wo man sie vollständig, klar und ohne Kompromisse sieht.“
Erich Fromm
Wahrheit muss radikal sein.
Der Begriff „Radikal“, der im Zitat von Erich Fromm sehr prominent steht, kommt aus dem mittellateinischen radicalis und meint „an die Wurzel gehend, von Grund auf, gründlich“.
Und ich denke, dass es Zeit ist, gründlich die Wurzeln sozialer Arbeit in den Blick zu nehmen und zu schauen, wie diese Wurzeln in die Zukunft führen können. Denn in diesen Wurzeln ist angelegt, dass Soziale Arbeit mehr ist als ein Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung des bestehenden Systems. Soziale Arbeit ist lebensrelevant.
Um jedoch auch zukünftig lebensrelevant zu bleiben, gilt es, jetzt aktiv zu werden.
Wir – die Professionellen der sozialen Arbeit, die Menschen, die Verantwortung tragen, müssen agieren und die Zukunft der Sozialen Arbeit in die Hand nehmen. Das geht aber nicht mehr, indem langfristige Pläne geschmiedet und diese dann mithilfe von Meilensteinen umgesetzt werden. Die komplexen Herausforderungen lassen sich nicht mit (mono-)kausalem Denken und Handeln lösen.
Vielmehr braucht es Kollaboration, Vernetzung, gemeinsames Miteinander, um kreativ neue Wege gehen zu können.
Das gilt auch und insbesondere mit Blick auf eine digitalisierte Welt, in der sich die Soziale Arbeit wiederfindet. Mehr noch:
Es gilt, jetzt wo der digitale Grundstein gelegt ist, weiterzumachen bzw. anzufangen digital zu denken und zu handeln. Es gilt jetzt und in Zukunft, die Kultur der Digitalität sozial zu gestalten, um auch zukünftig eine lebenswerte Gesellschaft für uns in der sozialen Arbeit und für alle Menschen zu gestalten.
Abschließend noch einmal der Hinweis auf die Definition Sozialer Arbeit. Der Satz, dass Soziale Arbeit gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen fördert, unterstreicht aus meiner Perspektive, dass die Gestaltung einer Kultur sozialer Digitalität radikal – also vom Grund auf und im Kern – Aufgabe sozialer Arbeit ist.
Jetzt und in Zukunft.
Jetzt bin ich gespannt: Was meint ihr? Was fehlt? Wo seht ihr die wesentlichen Veränderungen und Herausforderungen? Lasst doch einfach einen Kommentar da…
Oder Du trägst Dich einfach in meinen Newsletter ein und bekommst regelmäßig Updates zu spannenden Aspekten der Organisationsentwicklung von Organisationen der Sozialen Arbeit.
New Learning in der sozialen Arbeit
Beim Blick auf Lernen sind (mindestens) zwei Ebenen wichtig: die individuelle Ebene ebenso wie die organisationale Ebene (inkl. Ebene der Teams) des Lernens. Und gerade in der Sozialen Arbeit und in sozialen Organisationen sind wir darauf angewiesen, in Zeiten der Veränderung (VUCA-Blabla…) dringend neu, anders und weiter zu lernen. Hier kommt „New Learning“ ins Spiel, denn:
Das Lernen im Kontext von Dynamik und Komplexität funktioniert schon lange nicht mehr wie das aus Schule und Studium bekannte Lernen. Organisationales und individuelles Lernen wandelt sich radikal.
Aber der Reihe nach:
Im Beitrag erfährst du, was New Learning ausmacht, warum New Learning auch für Menschen in und für soziale Organisationen als Ganzes wichtig ist und wie Du (erste) konkrete Ansätze von New Learning für Dich und in Deiner Organisation umsetzen kannst.
Studien zur Situation der Personalentwicklung in Organisationen der Sozialen Arbeit sind spärlich gesät. Konkret die Frage, wie Lernen in unserer Branche stattfindet, welche Programme angeboten werden und welche Wirkungen was hat (auch wenn das nicht ganz einfach zu erfassen ist) lässt sich kaum beantworten. Das hat viele Gründe.
Eine sehr allgemein gehaltene These lautet, dass „Lernen“ in sozialen Organisationen nicht unbedingt einen großen Stellenwert hat. Stefan Gesmann von der FH Münster schreibt schon 2014, dass „die betriebliche Weiterbildung in Einrichtungen der Sozialen Arbeit oftmals nur unzureichend in das Managementhandeln von Leitungskräften eingebunden ist“. Und gemeinsam mit Berthold Dietz von der EH Freiburg habe ich beschrieben, „warum wir verpflichtende Weiterbildung in der Sozialen Arbeit“ brauchen.
Kurz: Hier ist viel Luft nach oben und einiges an Forschung und Entwicklung vonnöten.
Was ist New Learning?
Ich habe das Buch „New Work braucht New Learning – Eine Perspektivreise durch die Transformation unserer Organisations- und Lernwelten“ von Jan Foelsing und Anja Schmitz gelesen.
Falls Du Dich näher für das Buch oder meinen Eindruck zum Buch interessierst, findest Du hier eine ausführlichere Rezension auf dem Blog (und hier bei socialnet.de). Jedenfalls beziehe ich mich inhaltlich bei vielen Aspekten auf das Buch und ergänze die Ideen um spezifische Fragestellungen sozialer Arbeit und sozialer Organisationen.
Der Ansatz „New Learning“ versucht, die Herausforderungen der Veränderungen der Arbeitswelt und die Prinzipien von New Work (darauf ließe sich wiederum vertieft eingehen) mit der Frage zu kombinieren, wie wir als Individuen und als Organisationen jetzt und in Zukunft sinnvoll lernen.
Dabei steht ein Wechsel von tayloristisch geprägten, top-down organisierten und vorgegebenen Lernsettings hin zu zu bedürfnisorientierten, dynamik-komplexitätsrobusten, kollaborativen Lernökosystemen an, so die Autor*innen des Buchs. Lernen wird damit ein möglichst aktiver und sozialer Prozess, der bedürfnis- oder problemorientiert an echte Herausforderungen gebunden ist. Ziel ist, eine echte Verhaltensänderung herbeizuführen (vgl. ebd., 107).
Aktiv und sozial sind die wesentliche Stichworte:
Aktiv bedeutet, dass New Learning selbst gesteuert ist und sozial bedeutet, dass Lernen eingebunden in unterschiedlichste Netzwerke erfolgt. Hier liegen die wesentlichen Unterschiede zum „old learning“, wenn man diesen Begriff bemühen will:
Old learning basiert auf vorgegebenen, oftmals durch die eigene Organisation strukturierten Lernsettings. Diese von der Organisation angepriesenen „Fortbildungskataloge“, in denen Angebote aufgeführt sind, die niemand bucht, kennt wahrscheinlich jede*r von Euch, oder? Und wenn die Angebote gebucht werden, geht es vornehmlich um die Pausen, in denen man Menschen trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.
New Learning hingegen basiert auf der selbstgesteuerten, autonomen Gestaltung der eigenen Lernsettings wie auch der benötigten Lerninhalte. Und das Ganze findet dann eben noch eingebunden in analoge, hybride und/oder rein digitale Netzwerke statt.
Für mich ist das im Übrigen einer der wesentlichen Gründe, in den sozialen Medien aktiv zu sein:
Hier leben meine ganz individuellen Lernplattformen, meine Netzwerke und Communities (dickes Danke an dieser Stelle). Dabei geht es viel weniger um das reine Nutzen der Inhalte und Ideen der dort aktiven und weniger aktiven Menschen. Es geht um die co-kreative Gestaltung von neuen Ideen.
So kreiere ich meine Lernprozesse orientiert an meinen Bedarfen basierend auf unterschiedlichen Methoden als „Remix vielfältiger interner und externer Inhalte sowie im Austausch und co-Kreation mit [m]einen Learning Peers, selbst.“ (ebd., 108).
An dieser Stelle will ich nicht tiefer auf die neuen Lernmethoden eingehen, die genutzt werden können, um Kompetenzen für die Zukunft, sog. Future Skills, zu generieren. Es würde ausufern, hier Methoden von Working out loud #WOL über ambidextres Lernen bis hin zu Value-creation oriented Learning (VOL) zu beschreiben. Diese Methoden lassen sich bspw. im genannten Buch oder im Netz finden.
Wichtiger ist mir die Betonung, dass effektives Lernen von Individuen wie von Organisationen heute schon und in der Zukunft verstärkt zum einen zum zentralen Wettbewerbsvorteil wird (vgl. ebd., 160).
Zum anderen aber, und das finde ich noch relevanter, brauchen wir neue Lösungen für die gesamtgesellschaftlichen und auch globalen Herausforderungen der Zukunft. Diese Lösungen können wir nur durch Innovationen auf allen Ebenen und damit durch gemeinsames Neu- und Anders-Lernen gestalten, die, wie Scharmer schreibt, „die Fähigkeit zum gemeinsamen Spüren und zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft aufbauen“ (hier).
Auswirkungen von New Learning auf soziale Organisationen
Gibt es strukturierte Lernmöglichkeiten in Deiner Organisation?
Falls dem so ist, arbeitest du in einer Einrichtung, die nicht dem Standard entspricht. So lässt sich zwar konstatieren, dass soziale Organisationen, Non-Profits oder auch Organisationen der Sozialen Arbeit sehr personalintensiv sind, da die Leistungserbringung fast immer auf interpersonellen Austauschprozessen basiert.
Daraus folgt, dass die Menschen in den Organisationen wichtigste Ressource zur Wertschöpfung und gleichzeitig größter Kostenfaktor sind. Hinzu kommt, dass der Fachkräftemangel in einigen Arbeitsfeldern sozialer Arbeit existenzbedrohende Ausmaße annimmt.
Gerade unter diesen Bedingungen wäre es mehr als notwendig, effizient und effektiv, wenn Menschen ihre Kompetenzen bestmöglich einsetzen könnten. Denn die Mitarbeiter*innen sozialer Organisationen sind *die* strategisch wichtige, unverzichtbare Ressource (wenn man das so nennen will) zur Erreichung der Wertschöpfung der Organisationen (vgl. näher bspw. Englert, B. 2019, Personalmanagement in Nonprofit-Organisationen, S. 1).
Allein vor dem Hintergrund dieser minimalen Skizze ist es verwunderlich, dass der Personalentwicklung bislang so wenig Raum in sozialen Organisationen eingeräumt wird. Ja, I know, es ist keine Zeit und kein Geld da, aber der Waldarbeiter mit seiner ungeschärften Säge sollte uns warnendes Beispiel sein.
Mehr noch aber können Ansätze des New Learnings helfen, Lernen und Entwicklung und damit Innovation gerade in den hoch komplexen und anspruchsvollen Arbeitsbedingungen sozialer Arbeit unter Bedingungen begrenzter Ressourcen zu realisieren.
So geht es bei New Learning – der obigen Definition folgend – um das bedürfnis- und problemorientierte, selbstbestimmte Lernen, das an echte Herausforderungen gebunden ist. Beim New Learning geht es nicht mehr um die langweilige Weiterbildung, die in einem muffligen Keller-Raum der 60er Jahre („Das ist unser neues Innovation Lab, Steve Jobs hat auch so angefangen…“) verpflichtend abgehalten wird.
Es geht um die Frage, wer was – welche Inhalte, welche Verbindungen, welche Kontakte, welches Wissen, welche Ideen – zu welchem Zeitpunkt wofür braucht. Damit rücken gießkannenartige Weiterbildungskonzepte in den Hintergrund. Dem spezifischen, Problem-orientierten, individuellen Weg wird Vorrang eingeräumt.
Konkret ist dann nicht mehr der Master-Studiengang XY für die angehende Führungskraft sinnvoll, um „einmalig alles“ zum Thema zu erfahren, sondern peu a peu werden über ausgewählte Learn-Nuggets oder Micro-Learnings die für die neue Aufgabe wirklich benötigten Kompetenzen erworben.
Dieses Lernen erfolgt während bzw. parallel zur Arbeit und schont damit auch die Ressourcen, die sonst für ein langwieriges Bildungsprogramm aufgewendet worden wären (ich komme unten noch mal dazu, warum trotz aller Veränderung die traditionellen Programme ihre Berechtigung haben).
Wichtig im New Learning sind demzufolge zwei Dinge:
a) Es braucht eine grundlegende Kompetenz, selbstbestimmt und autonom lernen zu können (und zu wollen).
Und b) braucht es „Content Curation“, also die Aufbereitung und Zusammenstellung der unüberschaubaren Menge von (meist) frei verfügbaren Inhalten und die Begleitung der Menschen durch diese neuen Lernwelten.
Aus diesen beiden Aspekten folgt dann eine c) „New Learning Culture„, also eine Kultur, in der Lernen im Zentrum steht.
Kompetenz, selbstbestimmt zu lernen
Bei Punkt a) sehe ich einige Herausforderungen. So bereitet unser Bildungssystem im Kern nicht auf das selbstbestimmte, autonome Lernen vor, sondern verfolgt – verkürzt ausgedrückt – Prinzipien und Mechanismen, die vorhandenes Wissen in standardisierte und damit abprüfbare Einheiten unterteilen.
Hier sind wirklich gute Ansätze erkennbar, die jedoch vornehmlich von einzelnen, engagierten Menschen aus dem Bildungsbereich vorangetrieben werden. Systematische Veränderungen lassen – trotz Corona, Home-Schooling, Distance Learning… – seit etwa 60 Jahren auf sich warten. Das Bologna-System der Hochschulen hat übrigens nicht dazu beigetragen, hier auf akademischer Seite zeitgemäße Veränderungen herbeizuführen. Kurz: Lernen lernen muss man selbst lernen. Da ist viel Bedarf.
Content Creation
Und Punkt b) – Content Creation – ist in unserem Feld (ebenso wie in den meisten anderen Feldern) Neuland. Welches sind die „guten“ Inhalte, die Hand und Fuß haben? Wie komme ich daran, um meinen Bedarf jetzt zu decken? Warum ist es vielleicht nicht nur klug, meine Frage zum Thema XY in eine Facebook-Gruppe zu stellen? Wo kann man sonst noch schauen, um tiergehende Inhalte zu finden, die jetzt weiterhelfen? Wie baut man (s)eine Learning Community in und außerhalb der Organisation auf?
Diese und mehr Fragen sind oftmals unklar. Und gerade deshalb sind sie so wichtig – auch für die Soziale Arbeit.
Und noch einmal zu den Auswirkungen von New Learning (oder wie auch immer man das nennt…) auf soziale Organisationen insgesamt:
New Learning Culture
Ich bin davon überzeugt, dass sich für soziale Organisationen, die sich heute mit Fragen des Lernens von Morgen befassen und damit an ihrer eigenen Lernkultur arbeiten, enorme Wettbewerbsvorteile im Kampf um die besten Fachkräfte, vor allem aber echte Vorteile für ihre Klient*innen ergeben. Jan Foelsing und Anja Schmitz sprechen im Buch „New Learning“ von einer „New Learning Culture“, die sich zusammenfassend dadurch auszeichnet, dass
- dem Lernen ein hoher Stellenwert beigemessen wird, .
- kontinuierliches individuelles, team- und netzwerkorientiertes Lernen als zentral erachtet wird, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der anstehenden Veränderungen bewältigen zu können und
- Lernen hierbei als Basis für die nachhaltige Anpassungs-, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Organisation gesehen wird (vgl. ebd., 198).
Cool wäre manchmal wohl schon eine Learning Culture, ohne New…
Erste Schritte im New Learning, die Du direkt umsetzen kannst!
New Learning ist bzw. die Ideen hinter dem, wie wir in unseren Organisationen zukünftig mit Lernen umgehen werden, sind enorm umfangreich, komplex und vielfältig:
Vom Individuum angefangen über das Lernen im Team bis zur Organisation und den auf die Organisation einströmenden technologischen und gesellschaftlichen Anforderungen durch die Umwelt, in die die Organisation eingebunden ist, wird deutlich, dass neues Lernen ganzheitlich zu betrachten ist.
Das ist einerseits super, da auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt werden kann und Erfolge zu erzielen sind.
Andererseits ist es aber auch abschreckend, da überhaupt nicht klar ist, wo denn der beste „Hebel“ ist, an dem angesetzt werden kann. Das kann zum Erstarren oder dazu führen, einfach mal lieber nichts zu machen…
Und wo sind vor allem die Hebel, an denen Du „einfach“ ansetzen kannst, um weiter zu kommen?
Dazu hier ein paar Ideen:
Vision gestalten
Muhahaha…. Kleiner Schritt und wir beginnen wieder bei der Vision – also ganz oben?
Ja, aber mein Verständnis hier ist, dass Du die Vision auf alle angesprochenen Ebenen anwenden kannst: Auf die Organisation, Deine Abteilung und Dein Team und auf Dich selbst: Die Grundfrage lautet demnach:
- Wo willst Du (aka Dein Team, Abteilung, Organisation) hin?
- Wozu willst Du dich mit neuem Lernen beschäftigen?
Die Antworten darauf können sehr klein sein, aber das ist völlig passend: Die Intention, mit (neuem) Lernen zu beginnen, zählt – für Dich, Dein Team und Deine Organisation.
Exploitatives Lernen, oder: Herausforderungen identifizieren
Wo drückt der Schuh (wirklich)?
Die transparente Darlegung der aktuellen Herausforderungen, denen Du in der Arbeit auf individueller Ebene, auf Ebene der Teams und Abteilungen oder der Gesamtorganisation begegnest, zeigt Dir, wo wirklich Lernen angesagt ist, um zu neuen Ideen und Lösungen zu kommen.
Wenn klar ist, wo die Herausforderungen liegen, kannst Du Dich auf die Suche nach passenden Lern-Lösungen (vom YouTube-Video über Bücher, moocs und Blogs bis hin zu ganzen OE-Maßnahmen) machen.
Dieses Lernen lässt sich als „exploitatives Lernen“ definieren: „Exploitatives Lernen zielt auf Verbesserung der eigenen Kompetenzen, ihre möglichst effiziente Anwendung, sowie die Erweiterung, Verfeinerung oder Vertiefung von bereits bestehendem Wissen und Kompetenzen (…). Es geht also darum, die eigene Leistung im bestehenden Kontext möglichst schnell und kontinuierlich zu erhöhen, um die momentanen Aufgaben effizienter erledigen zu können“ (ebd., 111).
Lernen geschieht hier in der Absicht, bestimmte Lösungen zu generieren: Du hast ein Problem in Deinem aktuellen Arbeitskontext? Du brauchst eine Lösung in Deinem aktuellen Arbeitskontext!
Exploratives Lernen, oder: Lernen ohne Lösung
Was aber ist mit Lernen, das wirklich grundlegend Neues hervorbringt? Hier spricht man von „explorativem“, also dem entdeckenden Lernen: „Exploratives Lernen bezieht sich (…) auf die Erkundung von und das Experimentieren mit ungewohnten Kontexten und Fachgebieten, das Verlernen von Gewohntem, das sich Einlassen auf bisher „undenkbare“ Perspektiven, d. h. auf Lernen außerhalb der aktuellen Wissensdomänen. Dazu gehören Verhaltensweisen, wie z.B. suchen, variieren, experimentieren, spielen, oder entdecken, die ein tieferes Lernen ermöglichen“ (ebd.).
Die Herausforderung explorativen Lernens besteht darin, dass es nicht unmittelbar „nutzbar“ ist und trotzdem enorme Relevanz hat:
Ohne neue Ideen, ohne Innovation und wirkliche Entwicklung wird jede Organisation früher oder später in Schieflache geraten. Und trotzdem ist es nicht einfach, gegenüber Vorgesetzten die Notwendigkeit explorativen Lernens zu begründen.
Manche Arbeitgeber stellen ihren Mitarbeiter:innen 10% der Arbeitszeit zur vollkommen freien Verfügung bereit. In dieser Zeit können sich die Mitarbeiter:innen mit was auch immer beschäftigen und weiterbilden. Das sind optimale Bedingungen, um exploratives Lernen zu ermöglichen.
Deine Lernformate finden
Was sind Deine Lernformate? Diese Frage klingt trivial, ist aber mehr als wichtig: Bislang definierten wir Lernen in und für unsere Arbeitswelt und damit „Corporate Learning“ meist als staubig, trocken und in irgendwelchen Tagungshotels stattfindend – Wasser, Kaffee und Butterbrezeln inklusive.
Wenn „New Learning“ aber – wie oben definiert – ein möglichst aktiver und sozialer Prozess ist, der anhand Deiner Bedürfnisse bzw. Probleme echte Herausforderungen lösen will, ist es unabdingbar, dass Du Lernen für Dich in Deinen Formaten definierst. Die Formate können dabei komplett vielfältig sein:
- Blogs,
- Videos,
- Social Media,
- Podcasts,
- Barcamps,
- Bücher,
- Online-Kurse,
- Coachings,
- klassische Weiterbildungen,
- Formate wie Working out loud und ähnliche,
- …
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, flexibel und oftmals enorm kostengünstig. Was sind aber die für Dich geeigneten Formate, damit Du für Dich wirklich weiterkommst? Womit gelingt es Dir am Besten, Dein Bedürfnis bestmöglich zu erfüllen?
Die Beantwortung der Fragen setzt voraus, dass man sich mit diesen Themen befasst. Darin sehe ich leider ein immer noch großes Problem auch und gerade sozialer Berufe: Nein, nach dem Studium bist Du nicht „fertig“ mit Deiner Ausbildung. Ja, Du kannst immer noch Lernen und Dich verändern. Das musst Du aber wollen. Und – das ist die andere Seite – Du musst es (in Bezug auf Dein Arbeitsleben) dürfen. Deine Organisation muss Lernen aktiv zulassen. Leider ist auch das, wie schon gesagt, immer noch eine echte Herausforderung.
Fazit: New Learning ist (d)eine neue Welt
Es gibt noch drölfzig weitere Ansatzpunkte, „Dein“ und „Euer“ New Learning zu finden. Nicht berücksichtigt ist bspw. die Frage, welche technischen Voraussetzungen, aber auch welche technischen Unterstützungsmöglichkeiten denkbar und sinnvoll sind.
So ist dieser Beitrag in seiner ersten Fassung vor „ChatGPT“ entstanden. Die mit den LLMs einhergehenden Möglichkeiten für die Gestaltung von Lernen und Weiterbildung sind enorm.
New Learning ist – wie New Work – kein Programm, kein Rezept, nicht ein-, sondern vieldimensional und hochgradig spannend.
Denn eins ist sicher: Lernen verändert sich massiv. Dabei ist es ganz egal, ob Du jetzt den Begriff magst oder nutzt oder nicht.
Diese Veränderung ist aus meiner Sicht definitiv zu begrüßen:
Wenn Autonomie und Selbstbestimmung nicht nur als Prämissen für New Work, sondern auch als Prämissen für New Learning, also das Lernen der Zukunft, fungieren, kann es nur gut werden.
Lernen bedeutet dann nicht mehr, sich einmalig und verpflichtend oben Wissen reinzustopfen, das von außen aufbereitet und vorgegeben und noch abgeprüft und wieder vergessen wurde.
New Learning ist emotional, interessen- und fähigkeitengeleitet, an individuellen Anforderungen und Bedarfen orientiert. Das war (echtes) Lernen zwar schon immer, aber angesichts unserer Herausforderungen wird immer deutlicher, dass es klassisch nicht mehr geht. Somit:
Such Dir Netzwerke und Unterstützung und begib Dich auf Deinen Weg hin zum New Learning.
Aber, und das ist mir abschließend mit Blick auf soziale Organisationen wichtig:
Wir sehen eine Menge Menschen, die nicht „gelernt“ haben, wie sie neu Lernen können. Gerade in sozialen Organisationen haben wir es in vielen Fällen mit Menschen zu tun, die extrem negative Schul- und Lernerfahrungen gesammelt haben, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und die ganz grundlegende Schwierigkeiten in der Gestaltung des Lebens nach „unserer Normalität“ haben.
Soziale Organisationen sind dafür da, Menschen in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung zu unterstützen (vgl. Definition Sozialer Arbeit). Um dies auch auf Ebene des Lernens gewährleisten zu können, sind wir – die Professionellen in der Sozialen Arbeit – verpflichtet, uns mit neuen Wegen des Lernens zu befassen. Nur so kann es gelingen, die Klient*innen auf ihren „New Learning Wegen“ zu begleiten.
Ach, und noch was: Vielleicht sind die Lernwege der Klient *innen viel näher am New Learning als das, was wir mit unserer professionellen Brille als „richtig“ empfinden?
Dieser Beitrag ist für die „Blogparade I/V: #NewLearning – was kann „Radikal Neu“ jetzt auch für das LERNEN bedeuten?“ leicht überarbeitet und aktualisiert worden. Deswegen: #NewLearning / #NextLearning 😉
Warum Einfachheit, Machbarkeit und Sinn so wichtig sind, oder: Gedanken zur organisationalen Salutogenese
Gesundheit und Krankheit sind in Zeiten einer Pandemie aus guten Gründen besonders relevant. Ich habe noch nie soviel „Bleib gesund“s unter Mails gelesen und in Gesprächen gehört. Und die aktuelle „Neue Narrative“ titelt in der aktuellsten Ausgabe entsprechend:
„Wir sind doch alle krank!“
Da kommt die Salutogenese um die Ecke: Wuhuu… Neues Fremdwort! Salutogenese, schon mal gehört? Wahrscheinlich schon, denn gerade im Kontext von Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens sollte die Idee hinter dem Begriff geläufig sein.
Spannend ist – und darum geht’s im Beitrag – die Übertragung der Idee der Salutogenese und deren Dimensionen auf Organisationen als soziale Systeme. Die Leitfrage lautet also:
Wie sehen gesunde Organisationen aus? Und wie können wir diese gestalten?
Aber der Reihe nach:
Was ist Salutogenese?
Salutogenese bezeichnet – so Wikipedia – neben einer Fragestellung und Sichtweise für die Medizin vor allem ein Rahmenkonzept, „das sich auf Faktoren und dynamische Wechselwirkungen bezieht, die zur Entstehung und Erhaltung von Gesundheit führen.“
Im Gegensatz zur Pathogenese, die die Krankheit in den Mittelpunkt stellt, wird bei der Salutogenese versucht, die drei Einflussfaktoren Verständnis, Machbarkeit und Sinnhaftigkeit als Kohärenzgefühle in den Mittelpunkt der Entstehung von Gesundheit zu stellen. Gesundheit ist damit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Risiko- und Schutzfaktoren stehen hierbei in einem Wechselwirkungsprozess.
Geprägt wurde der Begriff der Salutogenese durch den israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923–1994) in den 1980er Jahren. Ohne in die Tiefe zu gehen, war eine der Kernfragen seiner Forschung, wie es Menschen gelungen ist, unter den Bedingungen der KZ-Haft sowie in den Jahren danach ihre (körperliche und psychische) Gesundheit zu erhalten.
Gesundheit entsteht nach Antonovsky – wiederum sehr kurz gefasst – wenn Menschen ein Kohärenzgefühl haben.
Kohärenz umfasst nach Antonovsky die drei Dimensionen Verständnis, Machbarkeit und Sinnhaftigkeit :
- Verständnis meint die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen.
- Machbarkeit ist die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können – das Gefühl der Handhabbarkeit oder Bewältigbarkeit (ähnlich dem Begriff der ‚Selbstwirksamkeitserwartung‘ nach Bandura).
- Und Sinnhaftigkeit ist der Glaube an den Sinn des Lebens.
Heiner Keupp beschreibt die drei Komponenten des Kohärenzgefühl wie folgt:
„Kohärenz ist das Gefühl, dass es Zusammenhang und Sinn im Leben gibt, dass das Leben nicht einem unbeeinflussbaren Schicksal unterworfen ist.
- Meine Welt ist verständlich, stimmig, geordnet; auch Probleme und Belastungen, die ich erlebe, kann ich in einem größeren Zusammenhang sehen (Verstehensebene).
- Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Ich verfüge über Ressourcen, die ich zur Meisterung meines Lebens, meiner aktuellen Probleme mobilisieren kann (Bewältigungsebene).
- Für meine Lebensführung ist jede Anstrengung sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte, für die es sich zu engagieren lohnt (Sinnebene).“
Die drei Ebenen bzw. die Dimensionen Verstehbarkeit, Selbstwirksamkeit und Sinn machen demnach Gesundheit aus.
Das ist sehr nachvollziehbar: Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Leben für mich verstehbar, gestaltbar und sinnhaft ist, habe ich das Gefühl, lebendig, gesund zu sein, gestalten und mich entfalten zu können. Und dabei ist dieses Gefühl für jede*n von uns völlig individuell.
Wenn jedoch eine Dimension ins Wanken kommt, ich also den Überblick verliere, nicht mehr gestalten kann und/oder den Sinn meines Handelns oder mehr noch des Lebens verliere, gerät das komplette Konstrukt ins Wanken.
Schon hier kann man – mit Blick auf Führung und Personalarbeit, mit Blick auf HR, sehr tief einsteigen, damit die Menschen in den Organisationen gesund bleiben. So ist das Konzept der Salutogenese in der Mitarbeiterführung und Entwicklung sicherlich mehr als lohnenswert.
Mich interessiert aber, ob und wie es gelingen kann, die Dimensionen der Salutogenese auf Organisationen als Ganzes zu beziehen. Welchen Nutzen können also die Dimensionen der Salutogenese für Organisationen und Fragen der zeitgemäßen Organisationsentwicklung haben?
Und welche Handlungsoptionen lassen sich daraus ableiten?
Übertragung der Dimensionen der Kohärenz auf Organisationen
Noch einmal: Die Dimensionen Verstehbarkeit, Selbstwirksamkeit und Sinn machen Gesundheit aus. Wenn man Organisationen als soziale Systeme betrachtet (was für mich aus vielerlei Perspektive Sinn macht), kann man davon sprechen, dass Organisationen „lebendige“ Eigenschaften aufweisen. Denn „weder Menschen noch die Organisationen, in denen sie arbeiten, [sind] Maschinen.“ (Neue Narrative, #12, S. 16).
Aus diesem Verständnis heraus entwickeln Organisationen sich selbst, wollen von sich aus „lebendig bleiben“ (Autopoiese) und sind – ebenso wie das psychische System der Menschen – als nichttriviale Systeme nicht steuerbar im maschinellen Sinn.
Apropos Sinn…
Sinn
Sinn – als erste der Kohärenzdimensionen – wird dahingehend wichtig, wenn man den Zweck einer Organisation betrachtet: Organisationen benötigen zum Überleben einen Zweck, eine Existenzberechtigung. Organisationen ohne Zweck sterben. Oder sie werden künstlich, mit viel Marketing, am Leben erhalten.
Genau wie Menschen einen Sinn benötigen, um gut arbeiten zu können, benötigen Organisationen einen Sinn. Schon hier stellt sich die Frage, wie der Sinn, der Purpose, das Zusammenspiel zwischen Vision und Mission in Deiner Organisation ausgeprägt ist? Wann hat sich Deine Organisation das letzte Mal mit ihrem Sinn befasst? Wozu existiert Deine Organisation? Hör mal genau hin, vielleicht ist es etwas anderes, als das, was Du glaubst?
Selbstwirksamkeit
Das Selbstwirksamkeitserleben bzw. die Selbstwirksamkeitserwartung ist nicht nur wesentlich für die Gesunderhaltung von Menschen, sondern auch für ihre Entwicklung. Denn wer daran glaubt, etwas bewirken und auch in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können, kann als Person gezielt Einfluss auf die Dinge und die Welt nehmen, statt äußere Umstände, andere Personen, Zufall, Glück und andere unkontrollierbare Faktoren als ursächlich für das eigene „Schicksal“ anzusehen (vgl. Wikipedia).
Wenn mir – was ja nunmal vorkommt – das Leben Aufgaben stellt, die ich lösen kann, geht es mir gut. Ich verfüge über Ressourcen, die ich zur Meisterung meines Lebens, meiner aktuellen Probleme mobilisieren kann. Und für Organisationen gilt das Gleiche: Welche Aufgaben sind zu bewältigen? Befassen wir uns mit dem, was wir können? Denn nur daraus erwächst (Selbst-)Wirksamkeit.
Verstehbarkeit
Verstehbarkeit bedeutet, die Umwelt als geordnet, konsistent und erklärbar einzuschätzen. Menschen, die Begründungen für das finden, was sich um sie herum ereignet, gehen davon aus, dass auch künftig überraschend eintretende Ereignisse eingeordnet und erklärt werden können. Der Blick auf und vor allem der Blick in Organisationen zeigt jedoch, dass wir Organisationen geschaffen haben, die hochgradig kompliziert gestaltet sind. Regeln, Rituale, Vorgaben, Prozesshandbücher, QM-Richtlinien und vieles mehr sind nicht nur nicht mehr nachzuvollziehen oder verstehbar. Diese Strukturen von Organisationen führen zur Blockade der Möglichkeit, sich schnell an veränderte Bedingungen anpassen zu können.
Und genau das – diese Anpassungsfähigkeit – ist die berühmte Agilität, von der alle immer sprechen. Nicht umsonst überschreibt Jos de Blok (bspw. in diesem Video, aber auch an vielen anderen Stellen) den bzw. zumindest einen Aspekt des Erfolgs von Buurtzorg mit den Worten „keep it small, keep it simple“. Halte es einfach.
Halte Deine Organisation einfach.
Die Umschreibung des „Needing Principles“ mit den Worten „Do, what’s needed!„ unterstreicht diese Einfachheit, Verstehbarkeit eindrücklich.
Das ist im Kern auch der Grund, warum ich glaube, dass selbstbestimmt agierende Teams und Organisationen nicht nur – wie oftmals vorgebracht wird – ein Thema für „Akademiker*innen“ sind. Im Gegenteil wird erst durch das Wegfallen von Strukturen, Hierarchien, Machtspielchen und interner Politik Klarheit, Einfachheit und Verstehbarkeit geschaffen. So ließe sich andersherum argumentieren, dass die etablierten Strukturen unserer Organisationen viel mehr dem Machterhalt als der eigentlichen Wertschöpfung dienen.
Aus der Einfachheit heraus ergibt sich im Übrigen viel Raum und Freiheit für die so viel beschworene und in vielen Bereichen wirklich benötigte Innovation.
Schlussfolgerungen für die Organisationsentwicklung
Es wurde deutlich, dass die Übertragung des Konzepts der Salutogenese auf Organisationen durchaus sinnvoll sein kann.
Verstehbarkeit, Selbstwirksamkeit und Sinn sind nicht nur für Menschen, sondern auch für Organisationen in einer sich dynamisch verändernden, komplexen Welt erstrebenswerte Aspekte, um „gesund zu bleiben“.
Es geht darum, überschaubar und nachvollziehbar sinnvoll handeln zu können.
Aber was kannst Du in Deiner Organisation konkret tun, um einen Schritt weiter zu einer gesunden Organisation zu kommen?
Dazu hier ein paar Ideen für
Verstehbarkeit:
- Habt ihr eure Prozesse dokumentiert? Falls nicht: Machen! Denn es hilft ungemein, wiederholende Prozesse einmal zu fassen und dann auch anhand des PDCA-Zyklus weiterzuentwickeln. Falls ja: Wann habt ihr euch im Team oder der Organisation das letzte Mal ernsthaft mit den Prozessen befasst, diese aktualisiert und entmüllt? Prozesse zu dokumentieren macht nur Sinn, wenn diese dann auch gelebt werden.
- Gibt es sonstige Regeln und Vorgaben, die ihr festgelegt habt und denen ihr folgen müsst? Machen diese Regeln und Vorgaben Sinn? Wenn nicht, weg damit.
- Wie ist die Aufbaustruktur der Organisation gestaltet? Wie viele Hierarchieebenen gibt es? Und machen die Sinn? Wenn nicht, lohnt es sich perspektivisch, diese abzubauen. Das klingt einfacher, als es ist, aber das Ziel einer verständlichen Organisationsstruktur wäre ja eine echte Vision, oder?
- Wie steht es eigentlich um die Strategie in der Organisation? Klar gibt es eine (hoffentlich…), aber ist diese auch den Mitarbeiter* innen bekannt. Und mehr noch: Kennen die Mitarbeiter* innen und Teams ihre Aufgaben und Projekte, mit denen sie zur Erreichung der Strategie beitragen? Falls nicht, lohnt es sich, die Strategie noch einmal genauer anzuschauen und gemeinsam Ziele zur Erreichung der Strategie auf den unterschiedlichen Ebenen der Organisation abzuleiten.
- Und überhaupt Transparenz: Wie transparent sind Entscheidungen? Wie transparent ist die Kommunikation in der Organisation? Wie transparent sind auch die finanziellen Kennzahlen der Organisation? Denn: Wir können von den Mitarbeiter* innen nicht verlangen, dass sie Verantwortung übernehmen, wenn die Rahmenbedingungen unklar sind.
Selbstwirksamkeit
- Ist der Gesamtorganisation klar, was Mission und Vision, was Purpose der Organisation ist? Das ist gerade bei sozialen Organisationen gar nicht so einfach, denn man kann ja irgendwie alles. Was aber gehört nicht zum Aufgabenbereich der Organisation? Was kann und muss von anderen bearbeitet werden?
- Ist allen Mitarbeiter*innen auf Teamebene klar, was Vision und Mission ihrer Arbeit ist? Falls nicht macht es Sinn, im Team über die Aufgaben und die Ausrichtung des Teams gemeinsam zu sprechen. Wozu ist das Team da?
- Gibt es in der Bearbeitung von Aufgaben eine Überschneidung dessen, was die Mitarbeiter *innen können, wollen und sollen? Das ist relevant, denn nur, wenn die Motivation mit den Fähigkeiten und Kompetenzen zusammenfällt und die dann hervorkommenden Ergebnisse noch das sind, was Aufgabe der Organisation ist, wird wirklich gute Arbeit geleistet. Was muss verändert werden, um eine Passung der drei Aspekte Wollen, Können und Sollen zu erreichen?
- Welche Herausforderungen auf individueller Ebene sind zu bewältigen, um die Selbstwirksamkeit im Beruf zu erhöhen? Sind die Mitarbeiter*innen in der Lage, sich selbst zu organisieren, so, dass sie nicht von den anfallenden Aufgaben überfordert sind? Man kann nur dann selbstbestimmt im Team arbeiten, wenn man seine Aufgaben und sich selbst (halbwegs 😉 gut auf die Reihe bekommt.
Sinn
- Mal ehrlich: Wenn man davon ausgeht, dass Deine Organisation ein soziales System ist: Was würde die Organisation selbst sagen: Macht das, was sie tut, Sinn?
- Und ebenfalls ehrlich: Wenn es keinen Sinn macht, ist es auch OK, eine Organisation, ein Projekt oder ein Produkt sterben zu lassen. Manchmal macht der Neuanfang mehr Sinn.
- Über Purpose, Vision und Mission habe ich ja schon geschrieben. Aber kennst Du die Vision, Mission und Purpose Deiner Organisation? Wirklich? Und macht das noch Sinn? Und wird das, was in der Vision, Mission und dem purpose steht, in konkrete Strategien übersetzt? Was also hat Deine Arbeit mit dem zu tun, was Sinn macht?
Naja, kann man ja mal drüber nachdenken…
Oder konkret dran arbeiten.
Wenn Du dabei Unterstützung brauchst, sag gerne Bescheid 😉
Lauf davon, oder: (alte und neue) Lieder über (alte und neue) Arbeit
Frithjof Bergmann ist gestorben.
Ich will und kann nicht viel darüber schreiben, da ich ihn persönlich nicht kannte. Aber das bzw. besser: sein Thema „New Work“ wird mich begleiten, vermutlich auch bis an mein Lebensende.
Danke für die Inspiration!
Vielleicht als meinen kleinen, unbedeutenden Anteil habe ich Dir (und mir) eine Playlist bei Spotify erstellt, in der ich Lieder über Arbeit sammle. Diese Lieder zeigen Bilder, Glaubenssätze, Haltungen zum Thema neue und alte Arbeit. Mit „New Work“ im Sinne von Bergmann haben die Lieder insofern zu tun, als das Bild der „Lohnarbeit als milde Krankheit“, die Unverbundenheit der Menschen zu ihrer Arbeit, die Hierarchien etc. immer wieder durchscheinen – beim Streik, bei der Steigerung des Bruttosozialprodukts oder bei der Aufforderung von Danger Dan, dringend davonzulaufen:
„Da war ein Job, einer mit flexibler Arbeitszeit
In einer hippen Agentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß
Jede Woche eine After Work-Party mit dem Chef
So ein Start-Up-Unternehmer, der Ramones-Shirts trägt
Ich schrieb grad die Bewerbungsmail mit meinem Lebenslauf
Und klebte ein sympathisches und seriöses Foto drauf
Als mir Lou Reed erschien und sagte: „Lauf davon!“
Schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen“
In einem Workshop am Wochenende habe ich mal wieder das Konzept der „Neuen Arbeit“ im Sinne von Bergmann besprochen. Wenn man nicht ganz an der Oberfläche bleibt (und New Work im Sinne der „Lohnarbeit im Minirock“ betrachtet) kommt die Radikalität der Theorie, der Werthaltungen, die Radikalität von Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie und Verbundenheit hinter dem Konzept von Bergmann, das aktueller denn je ist, schnell zum Vorschein. Kurz: New Work ist radikal.
Oder machst Du die Arbeit, die Du wirklich, wirklich tun willst?
Vielleicht kannst Du ja beim Hören der Playlist ein wenig darüber nachdenken…
Und, lieber Frithjof, vielleicht kannst Du ja auch da, wo Du jetzt bist, Musik hören?
Damit geht’s nämlich oft viel leichter…
Und die Playlist lebt natürlich auch durch Deine Hinweise hier oder in den Kommentaren…











Neueste Kommentare