Nach Part I – meiner New Social Work Definition – findest Du hier Part II der Serie „New Social Work Zwischenbilanz“. Darin werde ich auf meinen ganz persönlichen Weg hin zu New Social Work schauen und dann – anhand der vier Ebenen einer New Social Work (Individuum, Organisationen, Sozialwesen und Gesellschaft) etwas strukturierter die Anfänge der Entwicklungen rund um New Social Work darlegen.
Meine Anfänge rund um New Social Work
Damals, genauer 2014, habe ich – wie gesagt – das Buch „Reinventing Organizations“ verschlungen, erst auf Englisch als PDF, dann analog auf Englisch und Deutsch. Ich war fasziniert: Eine neue Art, Organisationen, Arbeit und übergreifend auch tradierte Grundprinzipien unseres Lebens in unserer Gesellschaft zu (über)denken.
Kurz zur Wiederholung: Laloux hat damals eine Studie bei 12 Organisationen durchgeführt. Die Kriterien zur Auswahl der Organisationen waren: mind. 100 Mitarbeiter sowie mindestens 5 Jahre Arbeit nach Strukturen und Prozessen, Praktiken und Kulturen, die mit den Merkmalen des integralen evolutionären Paradigmas übereinstimmen.
Es wurden Fragen gestellt, die sich auf 45 Praktiken und Prozesse in diesen Organisationen beziehen. Dabei wurden zentrale übergreifende Organisationsprozesse wie Strategie, Marketing, Verkauf, Unternehmensführung, Finanzplanung oder Controlling sowie wichtige Prozesse im Bereich Human Resources (bspw. Einstellungen, Weiterbildungen) und „Praktiken des Alltags“ wie Meetings, Organisationsfluss oder die Ausstattung der Büroräume in den Fokus genommen.
Es wurde versucht herauszufinden, „ob und auf welche Weise sich die Praktiken der Pioniere von konventionellen Managementmethoden unterscheiden“ (ebd., 8).
Ohne hier in die Tiefe zu gehen, lässt sich das Ergebnis der Studie dahingehend zusammenfassen, dass die Studie die drei wichtigen „Durchbrüche“ oder Prinzipien Selbststeuerung (oder Selbstführung), Ganzheit und evolutionären Sinn als wesentlich für Organisationen des integralen evolutionären Paradigmas gezeigt hat.
Selbststeuerung bedeutet, dass alle Mitglieder der Organisation alle Entscheidungen selbst treffen können, sofern sie sich 1. den Rat der von der Entscheidung Betroffenen und 2. den Rat der Experten in der jeweiligen Angelegenheit eingeholt haben. Ein wesentlicher Aspekt ist hier die Transparenz und der Zugang zu Informationen, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden können.
Evolutionärer Sinn bedeutet, dass die Organisationen, in denen die genannten Prinzipien funktionieren, einem klaren Sinn, einem Unternehmenszweck folgen, der für alle Mitglieder der Organisation verständlich, einleuchtend und sinngebend ist. Dabei geht es nicht nur um die „Weltverbesserung“, auch bspw. der Zweck der Schaffung von Arbeitsplätzen in einer strukturschwachen Region kann sinnstiftend wirken. Mit klaren, auf den Zweck ausgerichteten, freien Entscheidungen aller Mitarbeitenden wären bspw. Zielvereinbarungen hinfällig, da jeder wüsste, welchen Beitrag er zur Erreichung des Zwecks zu leisten imstande ist.
Ganzheitlichkeit bedeutet, dass „der ganze Mensch“ mit all seinen Emotionen, Zweifeln, Gedanken usw. die Organisation mitgestaltet. Daraus entsteht einer Kultur der Offenheit, Wertschätzung und Akzeptanz.
Die Verbindung der bei Frederic Laloux formulierten Kernaussagen von „teal organizations“ – Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und evolutionärem Sinn – mit den grundlegenden Funktionslogiken sozialer Organisationen war augenöffnend.
Denn davon ausgehend, dass
- soziale Organisationen einen Zweck verfolgen, der sinnstiftend ist („Helfen“ oder Menschenrechte oder wie auch immer) und
- das Menschen, die im Bereich der Sozialen Arbeit tätig sind, über ein bio-psycho-soziales Menschenbild der „Ganzheitlichkeit“ aufgrund ihrer Profession verfügen (sollten) und
- darüber hinaus in der täglichen Arbeit immer wieder eigenverantwortlich, selbstgesteuert, idealerweise vor dem Hintergrund einer professionellen Haltung, mit entsprechendem Wissen, Kompetenzen und Methoden agiert und reagiert werden muss (wenn ich nicht blitzschnell eine Entscheidung treffe, haut der Jugendliche mir eine auf die Nase),
ist anzunehmen, dass Organisationen der Sozialwirtschaft „eigentlich“ das Ideal an eine neue Arbeitswelt, an eine „New Social Work“ verkörpern.
Der Blick auf und in Soziale Organisationen hingegen zeigte ein anderes, formal-hierarchisches Bild tradierter Organisationen, deren Mitglieder schon damals hohe Burn-Out-Raten aufwiesen und Sinnstiftung nicht unbedingt an erster Stelle stand.
Spätestens beim Blick auf einen Kernbereich sozialer Arbeit – die Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen – wurde deutlich:
Solange die Professionellen an vielen Stellen im Sozialwesen selbst nicht autonom und selbstbestimmt handeln können (begründet in organisationalen wie auch gesetzlichen Bedingungen) wird es schwer, wenn nicht gar unmöglich, Selbstbestimmung und Autonomie der Klient:innen zu stärken.
Seit diesem Zeitpunkt lassen mich Fragen rund um die funktionale Entwicklung, rund um die Gestaltung und das Design sozialer Organisationen nicht mehr los:
- Machen klassische Hierarchien Sinn, wenn es um die Stärkung von selbstbestimmt agierenden Teams geht?
- Wie organisieren wir Arbeit in der Sozialen Arbeit?
- Macht die Art, wie wir soziale Organisationen denken und gestalten, überhaupt Sinn?
- Welche Antworten können andere, auf den ersten Blick „moderne“ Ideen von Zusammenarbeit – bspw. die Ideen rund um Agilität – helfen, besser im Sinne der Nutzer:innen sozialer Dienstleistungen zu agieren?
- Wie kann es besser gelingen, soziale Organisationen zu gestalten?
Reinventing Social Organizations und New Work
Neben dem Blick auf die Gestaltung der Organisationen kam ein zweiter Aspekt hinzu: Die „Real New Work“ im Sinne Frithjof Bergmanns. Auch hier kurz zur Wiederholung zusammenfassend:
New Work wurde von Bergmann als Alternative zum vorherrschenden Lohnarbeitssystem beschrieben. Bergmann geht es darum, dass unser Lohnarbeitssystem von Grund auf zu den in unserer Gesellschaft zunehmend verstärkt auftretenden Problemen führt:
“Sie besondere Form der Arbeit, die wir ‚Lohnarbeit‘ nennen, ist erst so alt wie die industrielle Revolution, also ungefähr 200 Jahre. schon als dieses System eingeführt wurde, gab es warnende Stimmen, die ihm keine gute Zukunft voraussagten. heute krankt das Lohnarbeitssystem an vielfältigen und schweren Mängeln. Deshalb ist es an der Zeit, die Arbeit von Grund auf neu zu organisieren. das Lohnarbeitssystem ist dabei, zu sterben, und das nächste System, die neue Arbeit, muss aufgebaut werden.” (Bergmann, 2004, 11).
New Work nach Bergmann basiert darauf, das System der Lohnarbeit zu ersetzen durch ein System, das aus den drei Teilen
- – Erwerbsarbeit (1/3),
- – High-Tech-Self-Providing (Selbstversorgung, 1/3) und
- – dem „Calling“, der Berufung bzw. der Arbeit, die man wirklich, wirklich will (1/3)
besteht.
Hintergrund der Entwicklung des Konzeptes war schon damals die Feststellung, dass die „klassische“ Erwerbsarbeit insbesondere aufgrund der Roboterisierungs- und Automatisierungsprozesse zurückgehen wird. Aktuelle Entwicklungen rund um die sich mit enormer Geschwindigkeit entwickelnde KI unterstreichen die visionären Gedanken von Bergmann, dessen Ausführungen auf der zusammenbrechenden bzw. sich ins Ausland verlagernden amerikanischen Automobilindustrie in den 1980er/1990er Jahren und dem Niedergang von General Motors basierten. Sehr kurz dargestellt:
Es gab einfach deutlich weniger Arbeit – für (fast) alle Menschen!
Bergmann schlägt als Alternative zur Entlassung der von der Automatisierung betroffenen Menschen vor (bspw. 2/3 der Menschen) vor, die verbleibende Arbeit auf alle Menschen zu verteilen. Die Arbeitszeit jede:r Einzelnen sinkt (vgl. aktuelle Debatten um die Vier-Tage-Woche) – etwas schematisch – auf 1/3 seiner (Arbeits-)Zeit, die mit klassischer Lohnarbeit verbracht wird. Dafür aber gäbe es kaum vollständig arbeitslose Menschen.
Mit diesem ersten Drittel Erwerbsarbeit gelänge es, so Bergmann, eine finanzielle Basis für alle zu schaffen. Gleichzeitig werden durch das erzielte Einkommen Anschaffungen möglich, die nicht durch eigene Arbeit oder nachbarschaftliche Netzwerke erzeugt werden können.
Damit sind noch etwa 2/3 Zeit übrig. Das zweite Drittel der zur Verfügung stehenden Zeit sollte – so Bergmann – mit Selbstversorgung auf technisch höchstem Niveau zugebracht werden. Hier geht es nicht ausschließlich (aber auch) darum, Kartoffeln im eigenen Garten anzubauen. Es geht darum, mit den heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (bspw. 3D-Druck) Dinge des täglichen Lebens (angefangen von der Kartoffel bis hin zu bspw. technischen Geräten) herzustellen.
Hinzu kommt, dass sich die Menschen zunehmend verstärkt Gedanken um den tatsächlich sinnvollen Konsum machen, wodurch sich der Bedarf nach Wachstum und neuen Produkten automatisch reduziert (vgl. hierzu die Notwendigkeit, ökologisch auf einen nachhaltigen Weg zu kommen). Außerdem bleibt Zeit, kaputte Dinge zu reparieren. Und immer noch bleibt 1/3 Zeit übrig.
Hier steht – als dritte Säule der „Real New Work“ – die Arbeit im Zentrum, die die Menschen „wirklich, wirklich tun wollen“:
Ausgehend von der Prämisse, dass Arbeit grundsätzlich – und vor allem in und nach enormen Krisen – niemals endet, wenn man Arbeit als über das Lohnarbeitssystem hinausgehend definiert (bspw. Familie, Pflege, Ehrenamt, Aufbau), ist dieser Bestandteil des Konzepts „Neue Arbeit/Neue Kultur“ (so Bergmanns Buchtitel 2004) als wesentlich, als Kern, anzusehen.
Bergmann favorisierte hier einen evolutionären Ansatz der Systemveränderung, der nur nach und nach erfolgen kann, vorangetrieben durch Menschen, die sich in ihrem Tun an ihrem „Calvin“, ihrer Berufung und damit dem orientieren, was sie wirklich, wirklich tun wollen. Aus seiner Perspektive brauchte es also Menschen, die sich als Vorbilder allmählich unabhängiger machen vom Lohnarbeitssystem durch Unternehmertum (im Besten Sinne) in Verbindung mit High-Tech-Selbstversorgung.
Zusammenfassend also soll New Work im Sinne Bergmanns die Abhängigkeit vom Lohnarbeitssystem für alle Menschen reduzieren und selbstorganisiert Selbstständigkeit, Freiheit und die Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglichen. Der Zwang zur beinahe ausschließlichen Partizipation an traditionellen Lohnarbeitsstrukturen, um damit den Lebensunterhalt zu bestreiten, kann sich damit auflösen.
New Work betrifft aus Perspektive von Bergmann damit über jeden einzelnen Menschen das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, als Ganzes. Das Konzept fokussiert auf die Frage, wie viel Selbstbestimmung und Eigenverantwortung den Menschen selbst zugetraut werden kann und darf.
Und Bergmann ging es an keiner Stelle seiner Veröffentlichungen um die Gestaltung von bestehenden Organisationen. Bergmann ging es um die Suche nach einem dritten Weg zwischen Sozialismus (keine gute Idee) und Kapitalismus (auch keine gute Idee).
Wie aber sähe eine Welt aus, in der wir nachhaltig, in Gemeinschaften, Communities und lokalen Netzwerken, das produzieren, was wirklich gebraucht wird? Eine Welt, in der die existierenden Dinge repariert und damit möglichst lange im Leben erhalten werden? Und eine Welt, in der die Menschen Zeit finden, das zu tun, was sie „wirklich, wirklich wollen“?.
Ziemlich utopisch, irgendwie, aber wiederum hat der Blick auf die Soziale Arbeit für mich das Feuer entfacht, stärker nachzudenken:
Soziale Arbeit fördert eben nicht nur die Selbstbestimmung und Autonomie von Menschen, sondern – so wie es in der internationalen Definition Sozialer Arbeit heißt – gesellschaftliche Entwicklungen. Und genau das ist doch das, was Bergmann impliziert hat:
- – Wie sähe eine Förderung gesellschaftlicher Entwicklungen aus, die „enkelfähig“ und damit nicht nur für ein paar wenige, privilegierte Menschen nützlich, sondern für – global – möglichst alle Menschen zukunftsfähig ist?
Die Verbindung der Gestaltung von lebendigen, zeitgemäßen und bedarfsgerechten sozialen Organisationen und der Gestaltung von einer enkelfähigen Gesellschaft führte zu meiner „New Social Work Definition“.
Die vier Ebenen der New Social Work Zwischenbilanz im Rückblick
Nach diesen doch etwas ausführlicheren Vorgedanken 😉 will ich zumindest noch kurz auf die vier Ebenen einer New Social Work (Individuum, Organisationen, Sozialwesen und Gesellschaft) schauen.
Das Individuum im Rückblick
Es gibt – allein in Deutschland – etwa 80 Mio. Individuen, Tendenz leicht sinkend. Entsprechend maße ich mir nicht an, pauschale Aussagen zu treffen. Aber es lassen sich doch Entwicklungen über die letzten 10 Jahre erkennen, die zumindest ich ganz spannend finde.
Im Jahr 2014 sah die Welt (sofern man die Augen nicht weit öffnete) noch ziemlich rosig aus. Die wirtschaftliche Entwicklung war nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 wieder grandios, Arbeitslosigkeit war kein Thema, Greta war auch Freitags noch in der Schule und der Klimawandel damit irgendwie noch nicht ganz so dramatisch. Selbst „die Digitalisierung“ steckte noch – zumindest mit Blick auf das Sozialwesen – in den Kinderschuhen.
Ich bin alles andere als Historiker, aber vielleicht war in der breiten Bevölkerung zu dem Zeitpunkt wirklich alles irgendwie „im Lot“. Danach ergaben sich aber ein paar Entwicklungen, die ich hier, auf individueller Ebene, herausgreifen will:
Spätestens im Jahr 2018, mit dem Beginn des Streiks von Greta und der Entwicklung von Fridays for Future unter dem Motto „Wir streiken bis ihr handelt!“ wurde der Freitag zum internationalen Streiktag, an dem Kinder und Jugendliche (!) auf die Straße gingen. Aber dem Zeitpunkt mussten sich auch Erna und Franz aus Hintertupfingen genauso Otto Normalverbraucher mit der Frage auseinandersetzen, ob Freitags zur Schule gehen wichtiger ist als die Rettung der Lebensgrundlagen des Planeten. Fridays for Future wurde DIE Bewegung, die in aller Munde war. Spätestens als Greta Thunberg bei Politiker:innen international Gehör fand und mit Barack Obama, dem Papst und vor der UNO sprechen konnte, war klar, dass es bei diesem Klima irgendwie doch Handlungsbedarf gibt (auch wenn der erste Bericht des Club of Rome bereits 1972 alles Wichtige rund um die zu erwartende Katastrophe dargelegt hat).
Der zweite „Einschlag“ kam dann zum Beginn des Jahres 2020 mit der Pandemie. Ich will hier nicht wiederholen, wie die Entwicklungen gelaufen sind, denn jede:r hat wohl noch eigene Bilder, Erlebnisse, dramatische Geschichten aber auch positive Errungenschaften im Kopf, die mit der Pandemie einhergingen. Meinen Pandemiebeginn habe ich damals hier verewigt.
Als wir dann alle irgendwie glaubten, dass jetzt auch mal gut sei mit der Dystopie, hat ein Verrückter aus Russland befohlen, die Ukraine anzugreifen und einen Angriffskrieg auf europäischem Boden anzuzetteln. Neben allem Schrecklichen eines Krieges war plötzlich jede:r ganz unmittelbar betroffen von steigenden Energiepreisen, von der Angst der zukünftigen Entwicklungen und, und, und…
Abschließend nur noch der Hinweis auf die aktuellen Entwicklungen rund um die künstliche Intelligenz bzw. konkret um die KI-basierte Textgeneratoren, allen voran ChatGPT:
Auch wenn es viele Fragen und Unklarheiten gibt, sind die Entwicklungen, die sich seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 ergeben haben, über einbrechende Börsenkurse bis hin zur Entlassung von angestellten Texter:innen, beachtlich. Für einen tieferen Einblick lohnen sich die letzten 30 Minuten des Podcasts „Jetzt mal ehrlich“ (Du musst Bock auf Start-Up-Denglisch haben).
Aus diesen nur skizzierten Entwicklungen folgt:
Wer sich mit Wandel schwertut, wird es in Zukunft schwer haben. Und unsere jede:r Einzelne und damit unsere Gesellschaft insgesamt tut sich wahnsinnig schwer mit Veränderungen. Wir sind es – etwas pauschal – als Individuen in den letzten 60 Jahren nicht mehr gewohnt, komplexe und dynamische Entwicklungen zu bewältigen und zu gestalten und müssen dies erst wieder lernen.
Für den Blick auf die Soziale Arbeit zeigt sich, dass die Entwicklungen der letzten Jahre die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, besonders hart treffen:
So ist der Klimawandel ein nicht nur ökologisches, sondern ein sozial-ökologisches Problem. Auf die massiven Auswirkungen der klimatischen Veränderungen insbesondere für Hilfsbedürftige – in Deutschland, Europa und natürlich auch global – weisen die Wohlfahrtsverbände an verschiedenen Stellen sehr deutlich hin (bspw. hier).
Die Steigerung der Energiekosten trifft – wenig verwunderlich – die von Armut betroffenen Menschen der Gesellschaft ganz anders als die „Oberschicht“ und auch die Auswirkungen der Roboterisierung und Technisierung und damit alles rund um KI und Co. sind ebenfalls für Menschen in prekären Lebenslagen massiver als für die „Bildungselite“ (für die diese Entwicklungen ebenfalls massive Auswirkungen haben werden).
Kurz: All die hier (alles andere als umfassend) skizzierten gesellschaftlichen Entwicklungen betrafen und betreffen jeden einzelnen Menschen und insbesondere das Klientel Sozialer Arbeit.
Ist es aber gelungen, passende Antworten – auch aus der Profession und Disziplin der Sozialen Arbeit heraus – auf diese Entwicklungen zu finden? In meinen Augen zeigen insbesondere die politischen Entwicklungen und konkret das Wahlverhalten, dass dies bislang leider nicht gelungen ist. Die demokratiezersetzenden Tendenzen sprechen Bände. Das liegt – so meine Einschätzung – an der wenig ausgeprägten Unsicherheitsbewältigungskompetenz, die für die aktuellen Zeiten notwendig ist. Dazu aber im nächsten Teil dieser Serie – dem Blick auf den Status Quo rund um New Social Work – mehr.
Die Organisationsentwicklung im Rückblick
New Social Work ist ziemlich komplex, das gebe ich zu. Vielleicht war das Komplexe auch ein Grund, warum meine Ausführungen zu New Social Work hier im Blog oder auch auf ersten Veranstaltungen, auf denen ich sprechen durfte, damals zwar auf Interesse, aber auch auf Kopfschütteln stießen („Spannend, ja, aber wie soll das denn gehen?“).
Gerade die „Profiteure des bestehenden Systems“ (Vorstände, Geschäftsführungen, Führungskräfte, politische Entscheidungsträger:innen) waren damals doch (diplomatisch ausgedrückt) „zurückhaltend“, was die Ideen zumindest rund um die Neugestaltung von Organisationen anging.
Und die gesellschaftlichen Megatrends steckten (aus meiner Perspektive) in den Kinderschuhen der Sozialwirtschaft:
- Die Digitale Soziale Arbeit nahm erst 2015/2016 so richtig Fahrt auf.
- Der demographische Wandel und der damit einhergehende Fachkräftemangel waren zwar am Horizont als dunkle Wolke erkennbar, aber der Regenschirm stand unbenutzt zu Hause.
- Und erst heute rückt die (sozial-)ökologische Nachhaltigkeit flächendeckend in sozialen Organisationen auf die Agenda, auch wenn der erste Bericht des Club of Rome auch damals nicht neu war.
Persönlich muss ich betonen, dass es richtig cool war und ist, dass es schon damals viele Menschen gab, die progressiv in die Zukunft geschaut, den Blog gelesen, die Ideen verstanden und geteilt haben. Viele Menschen im Digitalen und Analogen haben schon damals erkannt, dass es sinnvoll und notwendig war, das „Soziale“ neu zu denken. Und viele dieser Menschen sind für mich langjährige und treue Wegbegleiter:innen und Freund:innen geworden. Danke dafür!
Übergreifend aber war das Thema „Organisationsentwicklung“ noch nicht so präsent, wie es dann geworden ist. Zwar profitiere ich selbst natürlich von den Entwicklungen ;-). Und trotzdem ist Vorsicht geboten: Haben sich die Bedingungen wirklich verändert oder sitzen auch soziale Organisationen „Managementmoden“ auf?
Managementmoden lassen sich charakterisieren als „breit geteilte Vorstellungen darüber, wie Unternehmen, Verwaltungen, Krankenhäuser, Hochschulen, Schulen, Armeen, Polizeien oder Verbände besser organisiert werden können. Die Managementmoden suggerieren dabei, dass durch die Einführung neuer Gestaltungsprinzipien die Anpassungs-, Leistungs- und Innovationsfähigkeit erhöht werden können. Sie setzen mit diesem Versprechen an dem in Organisationen verbreiteten Bedürfnis an, wahrgenommene Defizite zu beheben und bisher nicht genutzte Verbesserungsmöglichkeiten zu erschließen“ (Kühl, 2022).
Und die Anziehungskraft von Reinventing Organizations in Verbindung mit dem aus der Softwarebranche ausbrechenden „agilen Management“ war enorm. Sätze wie „Endlich so arbeiten, wie wir das schon immer gewollt haben!“ oder „Selbstorganisation? Da kann ich dann endlich mal denen da oben zeigen, wie es richtig geht!“ oder „Wenn es gelänge, unseren Laden so richtig agil zu gestalten, wären alle Probleme der Welt gelöst!“ wurden zwar nicht explizit geäußert, implizit gab es aber schon eine „Goldgräberstimmung“, immer begleitet von einem sehr sympathischen Holländer, dem es gelungen ist, die Pflegebranche der Niederlande zu revolutionieren. Hier habe ich einmal dargelegt, warum Du Buurtzorg nicht als Vorbild nehmen solltest.
Und in einem meiner letzten Newsletter habe ich „vom Ende der Euphorie“ geschrieben. Darunter habe ich die Abkehr vom doch sehr utopisch anmutenden Frederic Laloux hin zum realen, etwas nüchternen Blick auf die Funktionsweise sozialer Organisationen als komplexe soziale Systeme verstanden. So machen formale Hierarchien genauso wie das Konzept der Trennung von Person und Rolle in Organisationen sehr viel Sinn (vgl. dazu ausführlich Matthiesen, Muster, Laudenbach, 2022).
Ich will und kann hier in diesem Beitrag nicht in die Tiefe gehen, aber die folgende Frage wurde in meinen Augen in den letzten Jahren zu wenig gestellt:
„Wenn Organisationsentwicklung hin zu mehr Agilität, Selbstorganisation und Co. die Lösung ist, was ist dann eigentlich unser Problem?“
Falls Du Lust auf mehr Theorie hast, empfehle ich Dir diesen Beitrag zur „dominierenden Informalität in Sozialen Organisationen“, in dem ich dargelegt habe, dass soziale Organisationen an vielen Stellen sogar stärkerer Formalisierung bedürfen und nicht das halbherzige Umsetzen der neuesten Managementmode.
Die Ebene sozialer Organisationen zeigt im Rückblick ein sehr differenziert zu betrachtendes Bild: Organisationsentwicklung war und ist dringend erforderlich, aber nicht unbedingt so, wie es, durch viele Managementmoden angetrieben, gerne propagiert wurde.
Das Sozialwesen im Rückblick
Im Jahr 2016 wurde das BTHG – das Bundesteilhabegesetz – verabschiedet. In der Pressemeldung damals hieß es, dass „das Gesetz (…) mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen“ schafft (BMAS, 2016). Für mich zeigt diese Entwicklung recht viel:
Einerseits zeigten sich in den letzten Jahren politisch wirklich gute Entwicklungen, die bspw. Menschen mit Behinderung oder auch Kinder (Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, inzwischen sogar ausgeweitet auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule) betrafen.
Bzgl. des BTHG sind Organisationen der Eingliederunghilfe zur Umsetzung des BTHG gefordert, neue Angebote und neue Organisationsstrukturen zu gestalten. Der Paradigmenwechsel von der Institutionenorientierung hin zur Personenorientierung ist hochgradig sinnvoll. Das BTHG soll die Teilhabe und damit die individuellen Rechte der Menschen mit Behinderung stärken. In der Praxis soll dies durch die Aufsplitterung der Betreuungsleistungen in Grund- oder Basismodule als Tagespauschale auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch verschiedene individuell bemessene Assistenz- oder Fachleistungsmodule, über die bedarfsabhängige und personenzentrierte Einzelleistungen abgebildet werden, geschehen (vgl. zu Fragen der Organisationsentwicklung und dem BTHG diesen Beitrag hier).
Der genauere Blick in die Herausforderungen zur Umsetzung der mit dem Gesetzesvorhaben BTHG einhergehenden Veränderungen zeigt jedoch auch viel Schatten:
Die Umsetzung ist zum einen eine enorme bürokratische Aufgabe und zum anderen lässt sich das BTHG auch als massives Sparprogramm lesen. So zeigt sich die Paradoxie des BTHG darin, dass auf der einen Seite damit geworben wird, die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Die Leistungen sollen sich am individuellen Assistenzbedarf orientieren und passgenau erbracht werden. Auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber klar formuliert, dass durch die Reform des BTHGs die seit Jahrzehnten ansteigende Ausgabendynamik gebremst werden soll (vgl. Bt-Drs. 18/9522, S.3). Auf diesen Widerspruch kann man eigentlich nicht oft genug hinweisen.
Ich erwähne das Beispiel BTHG hier – auf der Ebene des Sozialwesens – so ausführlich, da ich in den letzten Jahren kaum echte Verbesserungen im Sozialwesen erkennen konnte. Oft sind die Entwicklungen eher potemkinsche Dörfer anstatt echte Verbesserungen im Sinne der Menschen zu bewirken.
So zeigt auch das Beispiel Ganztagsbetreuung in der Grundschule ähnliche Schwächen: Schon zur Verabschiedung des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) war glasklar, wie sich die Personalsituation im Arbeitsfeld Erziehung und Bildung entwickeln wird. Wie kommt man also auf die Idee, ein Gesetz zu verabschieden, dass auf dem Rücken der Mitarbeiter:innen im Sozialwesen ausgetragen wird oder – auch keine bessere Perspektive – die Qualitätsstandards in der Ganztagsbetreuung soweit senkt, dass jeder Hans Wurst mit den Kids arbeiten kann („Waren Sie selbst mal Kind? Ja? Dann können Sie hier anfangen!“).
Du merkst – ich bin im Rückblick eher skeptisch, was die Entwicklungen des Sozialwesens angeht. Eine nachhaltige, zukunftsfähige „New Social Work“ im Sinne einer qualitativ hochwertigen Sozialen Arbeit, angeboten von zeitgemäß und bedarfsgerecht gestalteten Sozialen Organisationen, zur Förderung der gesellschaftlichen Entwicklungen (vgl. New Social Work Definition) ist kaum erkennbar.
Das hängt zu großen Teilen mit politischen Entscheidungen zusammen. Und Entscheidungen im politischen System sind leider alles andere als rational, wissenschaftlich fundiert oder immer so zukunftsfähig, wie es dringend nötig wäre.
Es geht im „System Politik“ nicht um die Leitdifferenz „richtig/falsch“, sondern um Mehrheiten, um Meinungen und um die Leitdifferenz „Macht/keine Macht“. Die Entscheidungen der Menschen im System, der Politiker:innen, orientieren sich – bewusst, meist aber unbewusst – an dieser Leitdifferenz.
Das erklärt die oftmals absurd wirkenden Äußerungen von Politiker:innen bspw. der konservativen Parteien aka CDU/CSU zu Themen rund um die Klimakatastrophe, voraussetzend, dass Merz, Söder und Co. nicht einfach nur dumm sind.
Und das erklärt eben auch die Entwicklungen rund um das ganze „Gedöns“ bzw. die Sozialpolitik, mit der für die politische Karriere kein Blumentopf zu gewinnen ist.
Ob sich das heute geändert hat und in Zukunft ändert? We’ll see in Part 3… Aber ich nehme sehr gerne Kommentare entgegen, die das Bild etwas positiver erscheinen lassen. Also:
Immer her mit den guten Nachrichten (bspw. hier in den Kommentaren oder unter diesem Link hier)!!!
Die Gesellschaft im Rückblick
Ich gehe hier nur noch sehr kurz drauf ein, da ich denke, schon zuvor, auf Ebene des Individuums und des Sozialwesens, einiges zur gesellschaftlichen Entwicklung geschrieben zu haben. Deswegen nur als Wiederholung:
Rückblickend lebten wir zwischen 2010 und 2020 in einer ziemlich ruhigen Dekade, die wirtschaftlich und politisch wenig Aufregendes gebracht hat. Ein Schelm, wer an die Angela denkt…
Nein, ernsthaft: Es ging bergauf, Sicherheit, zumindest die gefühlte Sicherheit, stand ob auf der Agenda. Und diese damals noch gefühlte Sicherheit wankt, an allen Ecken und Enden.
Das sind wir hier im globalen Norden in dieser Intensität nicht gewohnt. Entsprechend gespannt bin ich, wo es sich hinentwickelt.
Für das Sozialwesen bedeutet wirtschaftliches Wachstum und Stabilität natürlich auch (im Groben) „ruhige(re) Zeiten“, die sich schon jetzt und zukünftig weiter verändern werden.
Fazit Part II: New Social Work Zwischenbilanz und der Blick zurück
Puh, alles ganz schön komplex und an den wenigsten Stellen auch nur ansatzweise zu Ende diskutiert. Aber ich hoffe, einen kleinen Einblick in meine Gedankenwelt gegeben zu haben.
Spannend ist für mich jetzt die Frage, wie sich Deine Auseinandersetzung mit der Sozialen Arbeit, im Blick zurück und über die letzten 10 Jahre verändert hat?
Wo hast Du im Rückblick Verbesserungen erlebt? Wo ist es nicht besser geworden?
Ich würde mich riesig freuen, wenn Du unter diesem Link hier Deine Rückmeldung zum Blick zurück, zum Status Quo und zu einer wünschenswerten Zukunft teilen würdest… Die ersten Rückmeldungen trudeln über den Link bereits ein!
Danke dafür schon jetzt!
Quellen:
- Bergmann, F. (2004): Neue Arbeit, Neue Kultur. Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS, 2016): Bundesteilhabegesetz verabschiedet. URL: https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2016/bthg-verabschiedet.html. Download am 30.05.2023.
- Kühl, S. (2022): Managementmoden – Wie man unsicheres in sicheres Wissen verwandelt. URL: https://versus-online-magazine.com/de/kolumne/stefan-kuehl/managementmoden/ . Download am 30.05.2023.
- Matthiesen, K., Muster, J., Laudenbach, P. (2022): Die Humanisierung der Organisation. Wie man den Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. München: Verlag Franz Vahlen.




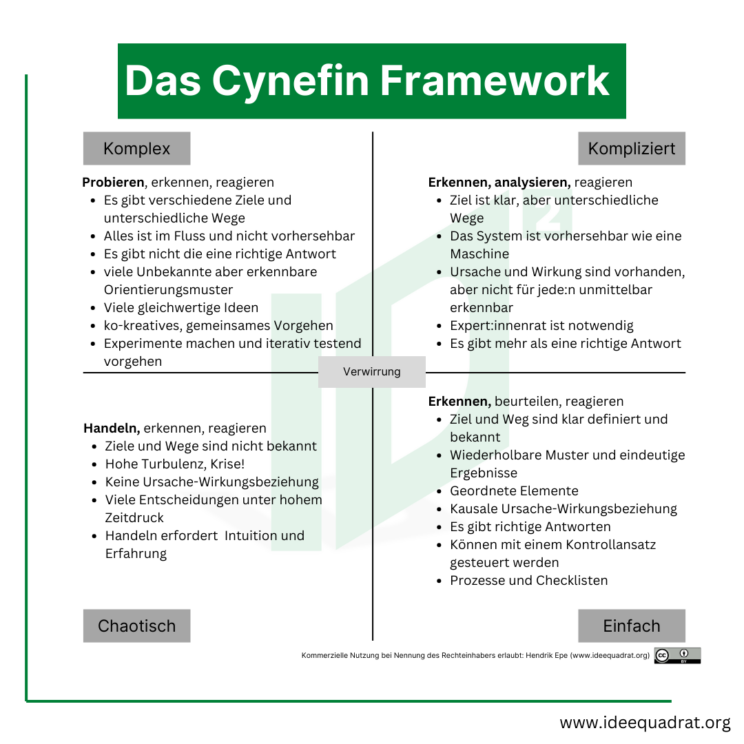
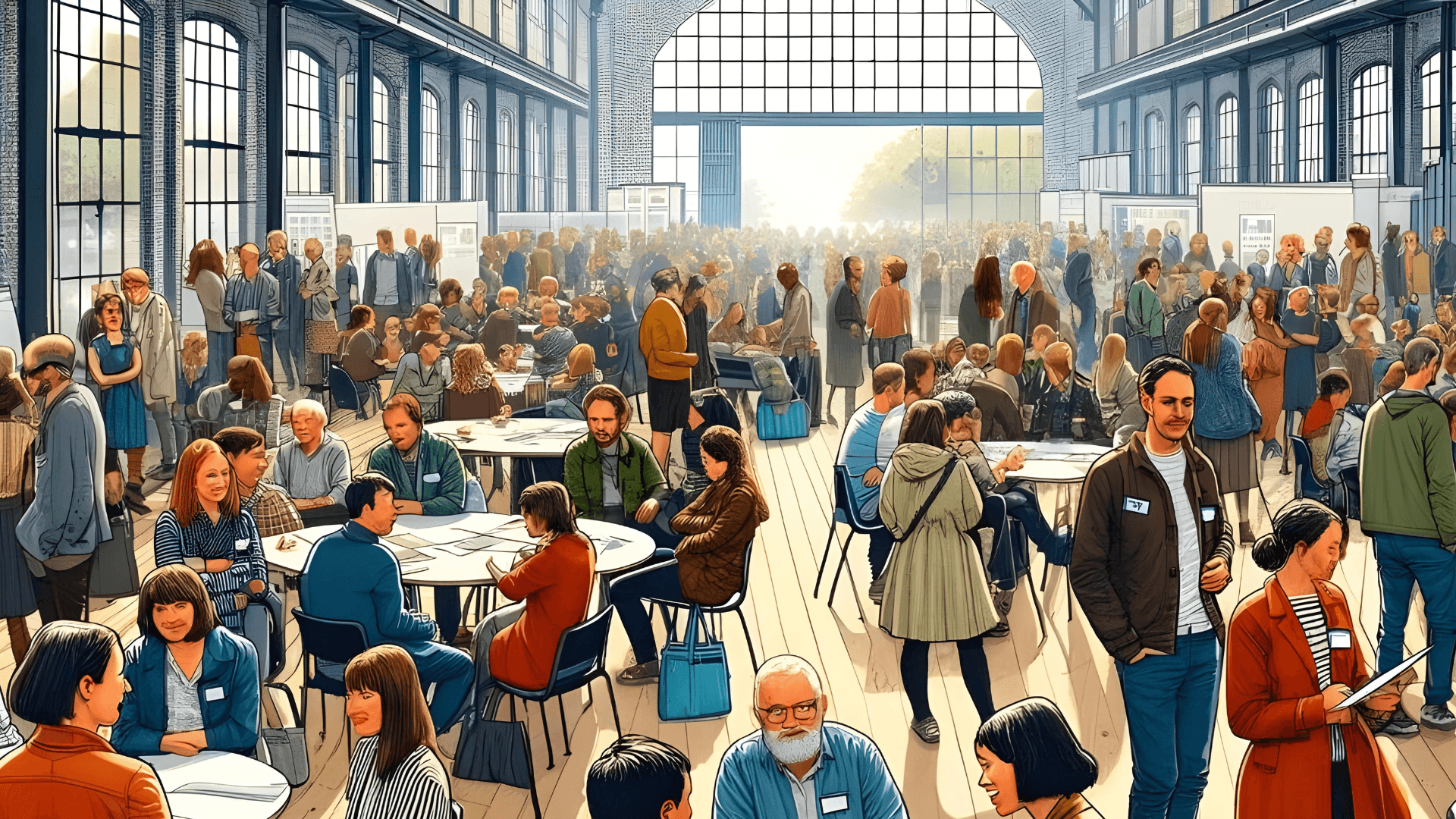






Neueste Kommentare