In der Zeitschrift „Neue Caritas“ schreiben Carsten Effert und Anne Huffziger von der Ambulantisierung des Stationären. Sie haben dabei das BTHG – das Bundesteilhabegesetz – im Blick. Wir wollen hier nicht in die Tiefen dieses neuen Gesetzes einsteigen. Wir behalten uns auch eine ausführliche Bewertung der Zielsetzung des BTHG vor. Vielmehr wollen wir aufzeigen, wie es Ihnen gelingen kann, die Herausforderungen der Angebots- und Organisationsentwicklung durch das BTHG gut zu bewältigen.
Wir – das sind diesmal Florian Acker und Hendrik Epe. Danke an dieser Stelle, lieber Florian, für Deine fachkundige Beteiligung am Beitrag.
Aber ganz ohne Bewertung des BTHG kommen wir nicht aus. Deswegen zu Beginn sehr kurz zwei Aspekte, die aus unserer Sicht mit Blick auf das BTHG nicht unter den Tisch fallen dürfen:
Stärkung der Position der Klient_innen
Auf der einen Seite des BTHG steht eine enorm positive Zielsetzung:
Der „Paradigmenwechsel von der Institutionenorientierung hin zur Personenorientierung“, wie die beiden Autor_innen im oben verlinkten Artikel schreiben, ist aus unserer Sicht hochgradig sinnvoll. Das BTHG soll die Teilhabe und damit die individuellen Rechte der Menschen mit Behinderung stärken.
Dies soll in der Praxis durch die Aufsplitterung der Betreuungsleistungen in Grund- oder Basismodule als Tagespauschale auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch verschiedene individuell bemessene Assistenz- oder Fachleistungsmodule, über die bedarfsabhängige und personenzentrierte Einzelleistungen abgebildet werden, geschehen (vgl. ebd.). Kurz:
„Die Leistungserbringung und Finanzierung der besonderen Wohnformen erfolgen zukünftig über zwei Stränge: personenbezogene Fachleistungsstunden und Tagespauschalen.“
Auch die Stärkung der Position von Klienten ggü. den Leistungsträgern und Leistungserbringern durch eine unabhängige Teilhabeberatung ist mehr als notwendig. Die zusammenfassend als Personenorientierung bezeichnete Entwicklung ist mehr als notwendig und entsprechend positiv zu bewerten. Denn es geht nicht um die Aufrechterhaltung der Organisation, sondern um die bestmögliche Leistung für die bzw. jeden einzelnen Menschen – und das betrifft alle Arbeitsfelder Sozialer Arbeit.
Einsparungen durch das BTHG?
Auf der anderen Seite wird in den betroffenen Organisationen deutlich, dass die Umsetzung des BTHG zum einen eine enorme bürokratische Aufgabe aka Bürokratiemonster ist und zum anderen als Einsparprogramm missbraucht wird.
Im zitierten Beitrag kommt dieser Aspekt nur an einer Stelle kurz durch, wenn es heißt, dass „es vermutlich zu einer deutlichen Ausdünnung der Personaldecke kommen“ wird.
Die Paradoxie des BTHG zeigt sich darin, dass auf der einen Seite damit geworben wird, die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Die Leistungen sollen sich am individuellen Assistenzbedarf orientieren und passgenau erbracht werden. Auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber klar formuliert, dass durch die Reform des BTHGs die seit Jahrzehnten ansteigende Ausgabendynamik gebremst werden soll (vgl. Bt-Drs. 18/9522, S.3). Auf diesen Widerspruch kann man eigentlich nicht oft genug hinweisen.
Als weiteres Beispiel für das Ziel der Einsparungen kann hier auch die neu eingeführte Differenzierung von „einfachen“ und qualifizierten Assistenzleistungen angeführt werden (vgl. § 78 Abs. 2 SGB IX).
Durch diese Differenzierung hat der Gesetzgeber erreicht, dass in der Eingliederungshilfe auch Nichtfachkräfte eingesetzt werden können bzw. sollen. Wenn also im Rahmen des Gesamtplanverfahrens Ziele für den Bewilligungszeitraum vereinbart werden, kann der Leistungsträger dabei Unterscheidungen treffen, bei welchen Zielen es sich um Assistenzfachleistungen (zu erbringen durch Heilerziehungspfleger_innen, Sozialarbeiter_innen, Erzieher_innen etc.) oder um „einfache“ Assistenzleistungen handelt. Die Intention ist klar:
Hierdurch können perspektivisch Kosten gesenkt werden.
Es kommen Inklusionsbemühungen im Schulsystem in den Sinn: Auch da wurden „Sonderschulen“ unter dem Deckmantel der Inklusion aufgelöste und die betroffenen Kinder in die Regelschulen verteilt, ohne für eine ausreichende Unterstützung der LuL zu sorgen. Diese waren mit dem Verhalten und den Besonderheiten der Kinder oftmals heillos überfordert, was – sehr diplomatisch ausgedrückt – sicherlich nicht überall zu Verbesserungen der Situation der Kinder mit Behinderung geführt hat. Aber es spart natürlich Kosten!
Organisationsentwicklung im Zuge des BTHG ist Angebots- und Strukturentwicklung
Hier wollen wir wie gesagt die Bewertung des Gesetzes nicht in die Tiefe fortführen (falls Sie einen Experten mit inhaltlichem Fokus suchen, steht Ihnen Florian Acker mit Rat und Tat zur Verfügung), sondern die Notwendigkeit zur Angebots- und Strukturentwicklung hervorheben.
Zur Notwendigkeit der Angebotsentwicklung
Das BTHG zwingt die Einrichtungen dazu, sich intensiv mit ihrem eigenen Leistungsangebot auseinanderzusetzen. So müssen sie zum einen wissen, welche neuen gesetzlichen Anforderungen an sie gestellt werden und zum anderen müssen sie das dann mit ihrem bestehenden Angeboten abgleichen und dann entsprechende Konsequenzen daraus ziehen.
Angeführt werden kann hier z.B. die (vollkommen berechtigte) Wirksamkeitsdebatte in der Eingliederungshilfe. Begriffe wie z.B. „Wirksamkeit von Leistungen“ oder auch „Wirkungskontrolle“ wurde vom Gesetzgeber wortwörtlich z.B. im Vertragsrecht mit aufgenommen (vgl. z.B: § 125, 128, 129 SGB IX).
Allein deswegen besteht schon die Notwendigkeit für die Leistungserbringer, dass sie ihre bestehenden Angebote evaluieren und ggf. anpassen und gleichzeitig neue Angebote unter der Prämisse der Wirksamkeit gestalten müssen.
Zur Notwendigkeit der Strukturentwicklung
Im Beitrag von Effert und Huffziger wird richtigerweise der mit der Umstellung vom Stationären zum Ambulanten notwendige Change Management Prozess – wir sprechen lieber von Transformationsprozess – angesprochen:
„Es muss für alle Beteiligten spürbar werden und sich ein konkretes Bild ergeben, was Personenzentrierung heißt. Insbesondere bei Fachkräften sollte es so gut wie nicht mehr vorkommen, dass diese ohne Klient(inn)en arbeiten. Es ist dabei eine wichtige Führungsaufgabe, die Mitarbeitenden sprichwörtlich in die „neue Welt“ mitzunehmen. Jahrelange Institutionenorientierung verschwindet nicht einfach aus den Köpfen, denn die alte Welt war nicht schlecht, sondern anders.“
Das ist ein sehr wichtiges und schwieriges Thema im Führungsalltag:
Gerade die langjährigen Mitarbeiter_innen in der Eingliederungshilfe (EGH) empfinden ihr bisheriges Tun und Handeln plötzlich als abgewertet. Hier braucht es viel „Fingerspitzengefühl“, um den Kolleg_innen deutlich zu machen, dass man die bisherige Arbeitsweise oder Erfolge nicht in Abrede stellt. Es gelten nun allerdings neue Anforderungen in der EGH, an denen man sich auszurichten hat.
Hinzuweisen ist außerdem darauf, dass sich die Teamkonstellationen bereits dadurch geändert haben, dass mittlerweile Nichtfachkräfte angestellt werden (in manchen Einrichtungen ist die Anzahl der Nichtfachkräfte fast höher als die Anzahl von Fachkräften).
Nach unserer Erfahrung ergibt sich bereits hierdurch Konfliktpotential, da durch die neuen Kollegen auch vieles in Frage gestellt wird (und manches durchaus zu Recht ;-).
Hier wird es in Zukunft wichtig sein, dass intern Möglichkeiten geschaffen werden, um die Nichtfachkräfte entsprechend zu qualifizieren. Man tut gut daran, entsprechende Bildungskonzepte zu entwerfen und Möglichkeiten zu schaffen, die Mitarbeiter_innen gut in diesem Handlungsfeld zu qualifizieren.
Die notwendigen Anpassungen jedoch bleiben nicht auf Ebene des individuellen Verhaltenswandels bzw. Kompetenzaufbaus stehen. Es geht – basierend auf einer passfähigen Strategie zum Umgang mit den Entwicklungen des BTHG und der Entwicklung neuer Angebotsformate – um die Entwicklung von Strukturen, die zu Kulturentwicklung führt.
Strukturentwicklung und BTHG
Aber wie kann die Strukturentwicklung bzw. die Entwicklung der Aufbauorganisation aussehen, wenn es gilt, die klassische Versäulung, die sich in den meisten Organisationen der Behinderten- bzw. Eingliederungshilfe findet, so zu transformieren, dass den Ansprüchen des BTHG Rechnung getragen werden kann?
Wenn Leistungen in Grund- oder Basismodule auf der einen und in verschiedene individuell bemessene Assistenz- oder Fachleistungsmodule, über die bedarfsabhängige und personenzentrierte Einzelleistungen angeboten werden, auf der anderen Seite aufgesplittet werden, gilt es, die bisherigen organisationalen Rahmenbedingungen und Strukturen hintenanzustellen und schnelle, individuelle Entscheidungen zu ermöglichen. Schnell und individuell reicht jedoch nicht. Es muss außerdem kompetenzübergreifend zusammengearbeitet werden.
Nicht mehr die Abteilungen sind als Entscheidungsstrukturen relevant. Ab-Teilungen sind das Gegenteil der geforderten, ganzheitlichen Personenzentrierung und Lebenswelt- sowie Sozialraumorientierung. Die Menschen mit Unterstützungsbedarf erwarten flexible, angepasste „Leistungen aus einer Hand“.
Konkret geht es um die konsequente Orientierung der Leistungsangebote am Sozialraum der Nutzer_innen. Damit geht eine Strategie des inklusiven Wohnens und Lebens einher. Nicht mehr der Bau von stationären Einrichtungen steht im Vordergrund, sondern der Aufbau von wohnortnahe Angeboten orientiert an der unmittelbaren Lebenswelt – im Gemeinwesen. Es geht auch um die Schaffung von Wahlmöglichkeiten, um individuelle, diverse Wohn- und Lebensformen zu schaffen.
Deutlich wird, dass die Fachlichkeit zur Gestaltung inklusiven Lebens in den Vordergrund rückt. Und deutlich wird auch die Ambulantisierung des Stationären:
„Durch das Herauslösen der Assistenz-/Fachleistungsmodule vollzieht sich der Übergang zu einem hybriden ambulant-stationären Setting“, wie es im Beitrag in der Neuen Caritas heißt.
Selbstbestimmt agierende Teams und das BTHG
In der Begleitung von Organisationen in diesem herausfordernden Transformationsprozess wurde deutlich, dass sich die klassischen Abteilungsstrukturen (bspw. gegliedert in Wohnbereiche) auflösen müssen und es damit zu sich völlig neu formierenden Teamstrukturen kommt.
Die Mitarbeiter_innen sehen in der Transformation die Möglichkeit, verstärkt selbstbestimmt im Sinne der Nutzer_innen agieren zu können. Hier finden Sie einen kleinen Auszug aus Rückmeldungen der Mitarbeitenden aus einem Transformationsprozess aus dem letzten Jahr. Im Kern stand an dieser Stelle die Frage, welche wesentlichen Chancen und Möglichkeiten sich aller Voraussicht nach durch die neue Struktur bezogen auf die Struktur der Organisation ergeben:
- „Flexibilität und selbstständiges Arbeiten“,
- „Vorhandene Instrumente (Führung/Personal etc.) nochmal kreativer gestalten. Neue Methoden bei Entscheidungsprozessen in Gruppen (kollegiale Beratungen)“,
- „Lernprozesse aufgrund multiprpfessioneller Teams werden angestoßen“…
Schon aus diesen wenigen Rückmeldungen wird deutlich, dass die Transformation der Strukturen zum „Neulernen“ auf Ebene der Kommunikation und Kollaboration der Teams führt. Insbesondere sind dies für uns die beiden Fragen:
- Wie gelingt Führung dieser neuen, oftmals größeren Teams?
- Wie gelingt erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der Teams, wenn diese „flexibler und selbständiger“ agieren?
Ade Mikromanagement, oder: New Leadership im BTHG
Führung und Zusammenarbeit müssen neu gedacht werden. Aber der Reihe nach:
Was kommt auf Führungskräfte zu? Was ist deren Aufgabe?
Für uns wird an dieser Stelle deutlich, dass Führungskräfte in den sich neu konstituierenden Teams nicht mehr für jeden Sch…nickschnack zuständig sein können. Die Komplexität aufgrund der Zunahme der Anzahl der Mitarbeiter_innen in den Teams steigt rasant.
Wenn sich klassische, operative Führung fortführen würde, wären die Führungskräfte mit der Kommunikation im Kleinen vollkommen überfordert. Wenn jede_r Mitarbeiter_in mit jedem Anliegen zur Führung rennt, macht diese nichts mehr anderes als Brände löschen und brennt dabei selbst komplett aus.
Führungskräfte sind in der neuen Struktur vielmehr dafür zuständig, die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter_innen so zu gestalten, dass diese „ungestört“ und damit selbstbestimmt und flexibel im Sinne der Nutzer_innen – fachlich – agieren können. Führungskräfte sind gefordert, an der Organisation bzw. den Strukturen und Rahmenbedingungen zu arbeiten und nicht mehr in den Teams.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Basis sind diejenigen, die maßgeblich am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind. Sie sind diejenigen, die die Assistenzleistungen erbringen und somit das Geld für die Einrichtungen verdienen.
Das Management sollte daher doch das größtmögliche Interesse daran haben, dass diese Mitarbeiter_innen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit vorfinden. Unserer Erfahrung nach ist dem häufig jedoch nicht so: Oft ist zu erleben, dass Mitarbeiter_innen im höheren Management meinen, dass sie die Bedürfnisse und Erfordernisse der Praxis besser kennen als die Mitarbeiter_innen an der Basis.
Es braucht eine Haltung des Vertrauens, um Verantwortung für den „Alltag“ in die Teams geben zu können. Es braucht ein Verständnis davon, dass Mitarbeiter_innen gerne arbeiten und ihre Leistungen für die Organisation auch dann einbringen, wenn sie nicht kontrolliert werden. Das Menschenbild der Theorie Y von McGregor kann hier hilfreich sein.
Welcome New Work, oder: New Collaboration im BTHG
Und wie gelingt jetzt Zusammenarbeit in den – meist sehr großen – Teams untereinander? Wie gelingt die Zusammenarbeit vor allem, wenn nicht wieder neue Strukturen von „Teamleitungen“ o.ä. installiert werden können, da diese die sowieso schwierige Finanzierung ins Wanken bringen würden?
Hier greifen die Merkmale selbstbestimmt agierender Teams, die wir in den folgenden sechs Schritten skizzieren:
- Es gilt, im Vorhinein den Rahmen zu gestalten, innerhalb dessen die Teams selbstbestimmt entscheiden und agieren können. Hier ist immer zu bedenken, dass die neu konstituierten Teams ja in bestehenden Organisationen eingebunden sind und nicht „auf der grünen Wiese“ neu gegründet wurden. Entsprechend sind bspw. die Satzung der Organisation sowie – selbstverständlich – gesetzliche oder arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten. Aber auch finanzielle Mindestanforderungen, die für ein erfolgreiches Bestehen der Teams notwendig sind, sollten in der Rahmenvereinbarung, die bindend für das jeweilige Team ist, festgehalten werden.
- Daran anschließend geht es an die Arbeit mit dem Team: Es ist der Zweck und die Vision des jeweiligen Teams zu definieren, um dessen „Nordstern“, dessen Ausrichtung festzulegen. Darüber, über diesen Nordstern, wird ermöglicht, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, die in die angestrebte Richtung gehen.
- Der dritte Schritt besteht in der Sammlung und Clusterung aller anfallenden, über die grundlegend pädagogischen Aufgaben im Team hinausgehenden Aufgaben. Als Beispiele sind dies: Urlaubsplanung, Dienstplanung, IT, Atmosphäre im Wohnbereich uvm.
- Schritt 4 ist die Definition von Mandaten, in denen die Verantwortlichkeiten und Aufgaben festgeschrieben werden. Bspw. macht ein Mandat „Interne Ansprechpartner_in“ Sinn, damit die Anliegen des Teams innerhalb der Organisation an die richtige Stelle kommen und Informationen aus der Organisation ins Team zurückgespielt werden. So ist es nicht zielführend, wenn „jede_r alles macht“. Die damit einhergehende Komplexität ist nicht handlebar.
- Anschließend steht der Wahlprozess an: In diesem Prozess wählen die Teammitglieder die Person aus, die als für das jeweilige Mandat am Kompetentesten erachtet wird. Dabei besteht auch die Möglichkeit, sich selbst wählen zu können. Aus Erfahrung ergeben sich schon in diesem Schritt die ersten echten Learnings: Nicht mehr der_die Vorgesetzte entscheidet, wer was macht, sondern die Teammitglieder entscheiden selbst, wer die Aufgaben und Verantwortung im Sinne des Teams übernehmen sollte.
- Schritt 6 ist dann die Umsetzung der neuen Mandate in der alltäglichen Arbeit. Das klingt einfach, ist in der Realität aber ein Paradigmenwechsel: Nicht mehr eine Person – der_die Vorgesetzte – entscheidet, sondern das Team bzw. die Verantwortlichen des jeweiligen Mandats im Rahmen der für das Mandat festgelegten Verantwortlichkeiten. Das muss geübt werden, da auch Konflikte und schwierige Entscheidungen nicht mehr „nach oben delegiert“ werden können.
Führung selbstbestimmt agierender Teams
Auch wenn es schon angesprochen wurde:
Aufgabe der Führungskräfte in dieser neugestalteten Angebots- und Organisationsstruktur ist es, die Teams dabei zu begleiten, Entscheidungen in Selbstorganisation treffen zu können, den Rahmen zu gestalten, in dem selbstbestimmtes Agieren der Teams möglich wird und die Strukturen immer weiter zu verbessern. Wie gesagt:
Für Führungskräfte steht nicht mehr die Arbeit im Team im Vordergrund, sondern die Arbeit an den Strukturen, innerhalb derer die Teams selbstbestimmt agieren.
Ebenfalls wiederholend ist zu betonen, dass die operative Arbeit in den Teams schnell zu einer Überforderung der Führungskräfte führen kann, da die Anzahl der Menschen in den Teams aufgrund der notwendigen Anpassungen oftmals sehr hoch sein muss. Die mit der Kommunikation einhergehende Komplexität ist dann kaum noch zu bewältigen.
Entsprechend gilt es, intern oder extern Lern-, Unterstützungs- und Austauschmöglichkeiten für die Führungskräfte zu gestalten, damit die neue Aufgabe, die vielmehr moderierend als steuernd und kontrollierend ist, bestmöglich gestaltet werden kann.
Fazit, oder: Die Chancen des BTHG nutzen
Abschließend hoffen wir, dass deutlich geworden ist, dass die durch das BTHG notwendig gewordenen Anpassungen Anpassungen an den Dienstleistungen, Produkten und Angeboten und gleichzeitig strukturelle Anpassungen bedingen:
Es ist zu überlegen, wie es gelingt, den Wandel insbesondere in stationären Settings hin zu einer “Ambulantisierung” zu vollziehen, um darüber möglichst wirksam Teilhabe für die Menschen zu ermöglichen.
Unser Ansatz in diesem Kontext ist, die Chancen und Möglichkeiten selbstbestimmt agierender Teams zu nutzen, um die Führungskräfte zu entlasten und aus der operativen Arbeit zu nehmen und gleichzeitig die Kompetenzen der Mitarbeiter_innen in der unmittelbaren Arbeit bestmöglich im Sinne der Nutzer_innen einsetzen zu können.
Dieser die Strukturen der Organisation betreffende Transformationsprozess hat dann den Kollateralnutzen, dass sich die Kultur der Organisation mit der Zeit verändert. Dabei darf nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass Transformation – egal welche – Ressourcen braucht und nicht zum Nulltarif und von heute auf morgen zu bekommen ist.
Diese Zeit sollten Sie sich geben, um das BTHG nicht nur als Bürokratiemonster zu verstehen, sondern die darin für die Nutzer_innen, aber auch die für die Organisation liegenden Chancen im Hinblick auf eine wirkungsvollere Praxis nutzen zu können.
Wir hoffen, dass Sie einige Anregungen mitnehmen konnten und freuen uns sehr über Ihre Kommentare.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Oder Sie tragen sich zum IdeeQuadrat-Newsletter ein und verpassen sicher keinen Beitrag mehr.
Ach ja, hier geht es direkt zum Blog von Florian Acker.
Und hier können Sie den Beitrag auch als PDF herunterladen.









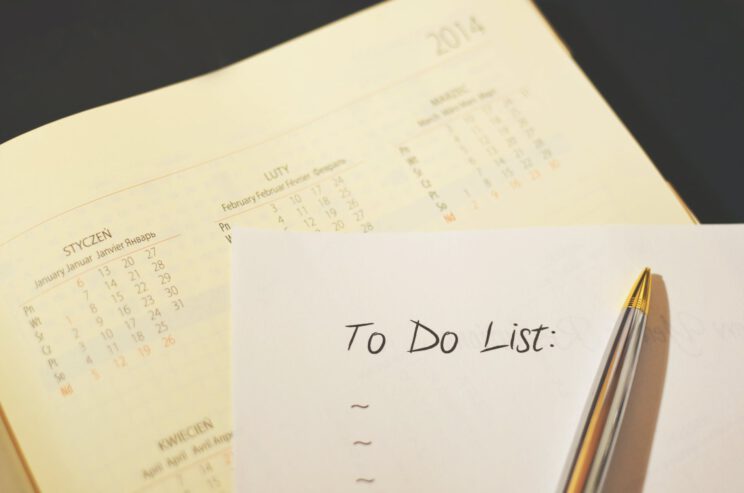


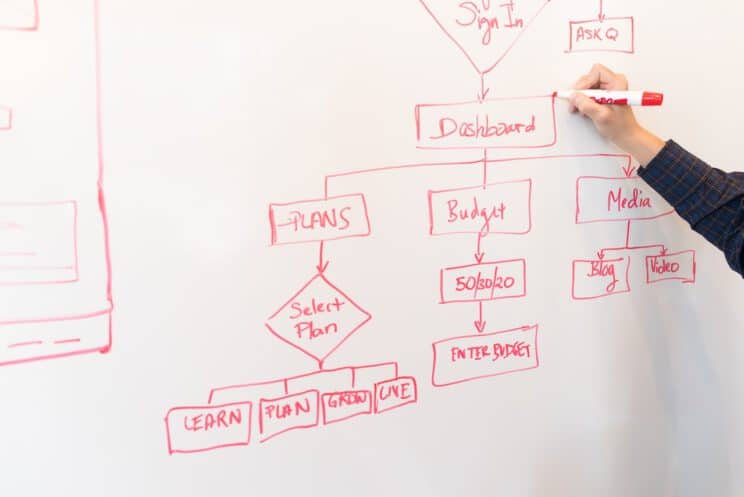








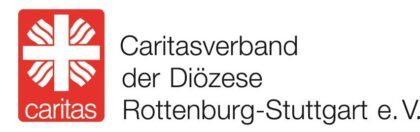











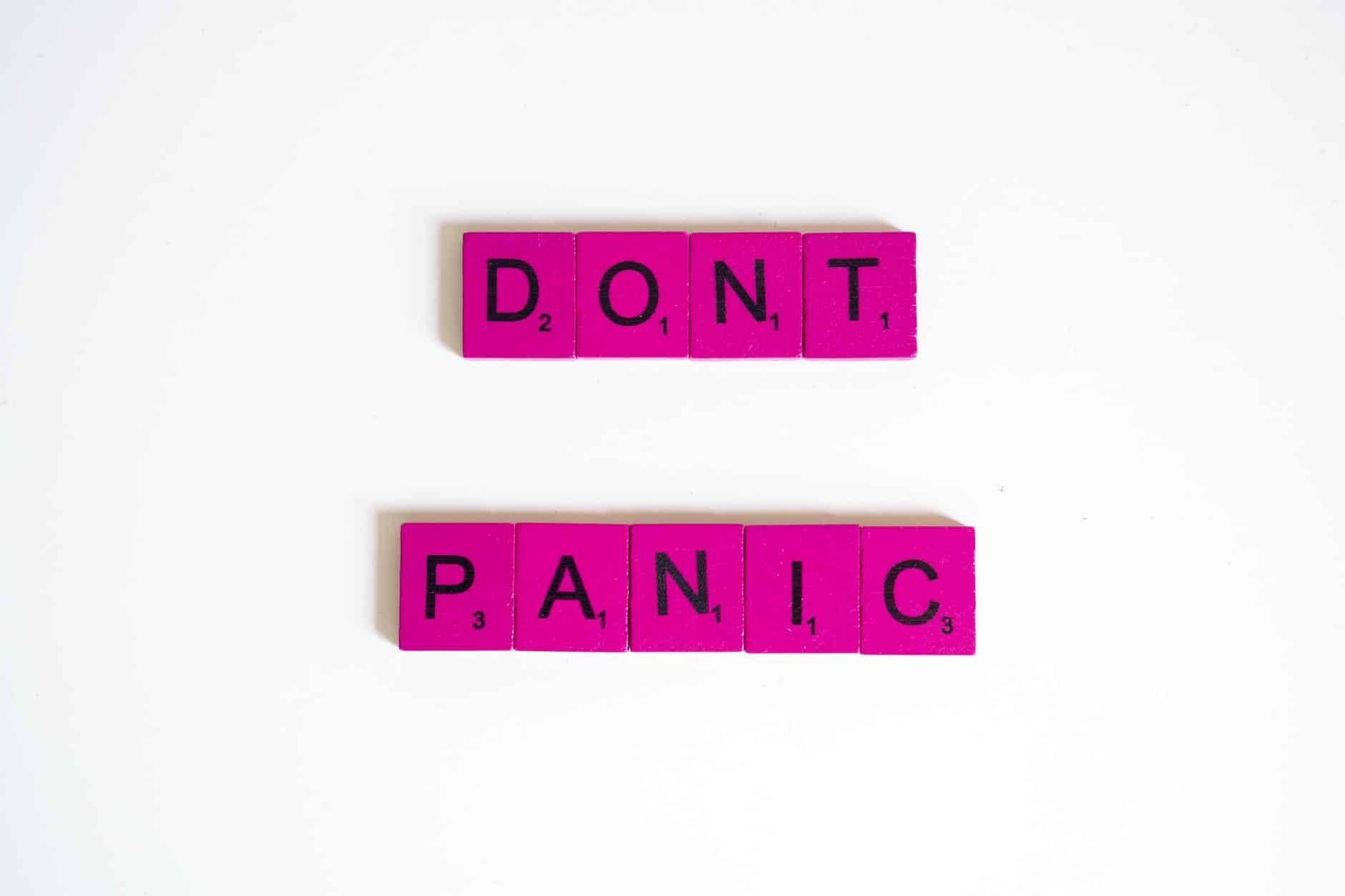

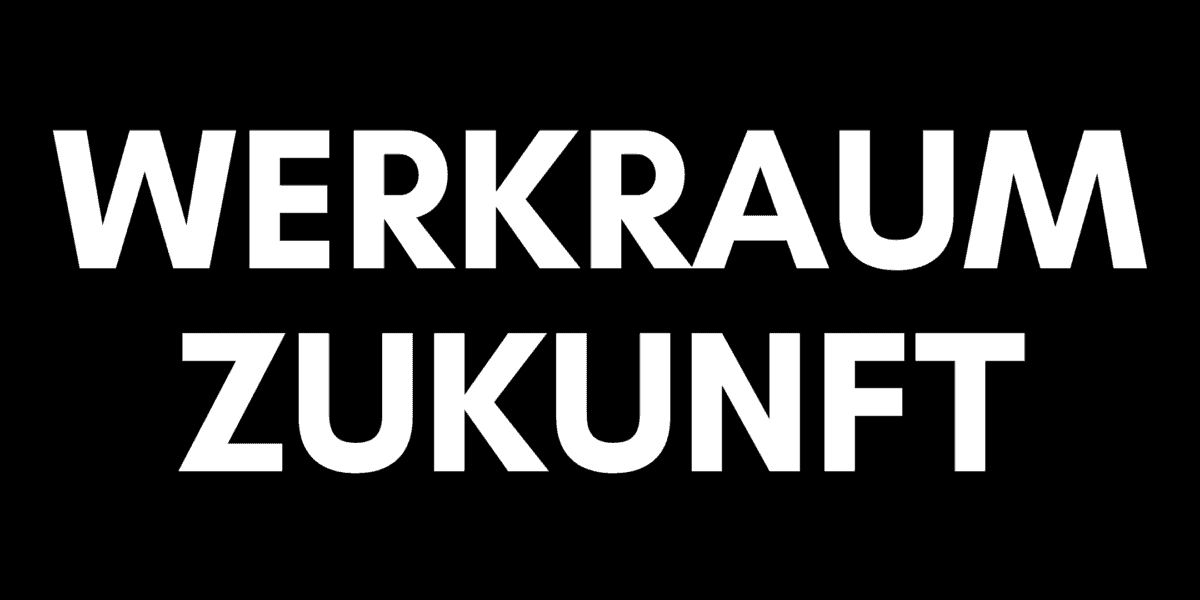




Neueste Kommentare