Was sind Organisationen? Die Frage ist schräg, oder? So bewegen wir uns doch alle „von der Wiege bis zur Bahre“ in Organisationen. Unser Leben wird von Beginn des Lebens bis zum Tod von Organisationen bestimmt – von Verwaltungen, Krankenhäusern, Kirchen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Parteien und in vielen Fällen auch von Wohlfahrtsverbänden, Kitas, Altenhilfeeinrichtungen. Das nehmen wir als selbstverständlich hin. Eine Vorstellung dessen jedoch, was Organisationen sind und wie diese funktionieren, wie man sich in ihnen bewegt und was in Organisationen verändert bzw. gestaltet werden kann, existiert kaum.
„Und selbst in Studienfächern wie Soziologie, Betriebswirtschaftslehre oder Psychologie wird man häufig nur in den jeweiligen Spezialisierungskursen darüber informiert, wie Organisationen eigentlich funktionieren. So lernen wir häufig lediglich nebenbei, wie Organisationen wirken und wie man sich in ihnen zu verhalten hat“ (Kühl, 2020, 1).
Herausfordernd an der Frage, was Organisationen nun eigentlich sind, sind verschiedene Aspekte, die auch und gerade für Beschäftigte in Organisationen der Sozialen Arbeit bedeutsam sind. Denn, wie Gesmann und Merchel (2019, 14) passend ausführen, wird „schnell erkennbar, dass der Begriff der Organisation eine gewisse Unschärfe aufweist. Arbeiten die Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) eines Jugendamtes nun in der Organisation ASD oder in der Organisation Jugendamt? Kann ein Arbeitskreis, der sich rund um das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bezirk gebildet hat, als Organisation bezeichnet werden? Was ist mit Einrichtungen, die sich einem Wohlfahrtsverband angeschlossen haben: Sind diese nun Organisationen, oder ist nur der Wohlfahrtsverband eine Organisation? Und ist eine Selbsthilfegruppe eine Organisation?“ Und wenn dann noch die Organisation der eigenen Hochzeit mit der Organisation Jugendamt in Verbindung gebracht wird, wird’s völlig wirr.
Ich will Dir hier aber nicht die komplette (und komplexe) Theorie dessen um die Ohren hauen, die es zur Differenzierung der verschiedenen Blickwinkel auf Organisationen gibt, sondern zur Komplexitätsreduktion den Begriff „Organisation“ eingrenzen auf „das soziale System Organisation“. Damit wird die Perspektive deutlich, aus der ich Organisationen betrachte und aus der auch die Ausführungen gedacht sind: Es ist die Perspektive der Systemtheorie.
Aus dieser Perspektive weisen Organisationen vier spezifische Merkmale auf, die sie abgrenzen von z.B. Familien oder Cliquen, die ebenfalls als soziale Systeme definiert werden können. Du wirst danach erfahren, warum es gut ist, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen und welche drei Seiten Organisationen aufweisen, die zu betrachten sich lohnt. Abschließend gehen wir dann noch auf vier verschiedene Typen von Organisationsstrukturen ein.
P.S.: Der Beitrag ist daraus entstanden, dass ich in Workshops und Weiterbildungen immer wieder ähnliche Ausführungen mache und es sich – vielleicht – lohnt, diese hier zum Nachlesen zu hinterlassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich perspektivisch weitere Auszüge aus Workshops und Weiterbildungen hier verschriftlichen (zum Beispiel bzgl. der Besonderheiten, die soziale Organisationen aufweisen).
Die vier spezifische Merkmale von Organisationen
Den Ausführungen von Gesmann und Merchel folgend (vgl. ebd., 14ff) lassen sich Organisationen anhand der folgenden vier grundlegenden Merkmale von anderen sozialen Systemen unterscheiden:
Organisationen weisen
- eine spezifische Zweckorientierung,
- eine geregelte Arbeitsteilung,
- Mitgliedschaftsbedingungen und
- eine Beständigkeit der Organisationsgrenzen auf.
Bei der spezifischen Zweckorientierung geht es darum, dass Organisationen einen oder mehrere spezifische Zwecke verfolgen. So lässt sich der Zweck von Organisationen der Sozialen Arbeit bspw. reduzieren auf „das Erbringen von personenbezogenen Dienstleistungen“, wobei diese Reduktion des „einen Zwecks“ spätestens beim Blick auf einen Wohlfahrtsverband ins Wanken gerät und mehrere Zwecke (bspw. untergliedert nach den jeweiligen Arbeitsfeldern, in denen Wohlfahrtsverbände Leistungen anbieten) zu berücksichtigen sind.
Die geregelte Arbeitsteilung als Merkmal von Organisationen wird in der Organisationsstruktur deutlich. Die Organisationsstruktur zeigt, „wer was wann und wie macht bzw. machen sollte“ (ebd., 15). Die Organisationsstruktur lässt sich als Regelwerk der Organisation definieren, die sich bspw. durch Prozessbeschreibungen im QM-System, durch das Organigramm oder auch Stellenbeschreibungen, Rollendefinitionen und die Ausführungen in den Arbeitsverträgen zeigt. Das ist die „Formalstruktur“ der Organisation. Besonders spannend ist, dass die Ausbildung formaler Strukturen immer auch die Ausbildung informaler Strukturen bedingt. Dazu gleich mehr.
Im Gegensatz zu bspw. Familien kannst Du in Organisationen Mitglied werden, indem Du – das dritte Merkmal – die Mitgliedschaftsbedingungen der Organisation (abgebildet in der Formalstruktur) erfüllst. Dafür, dass Du die Bedingungen erfüllst, erbringt die Organisation in der Regel die Gegenleistung „Gehalt“. Gleichzeitig kann die Organisation Deine Mitgliedschaft auch beenden, sofern Du die formalen Mitgliedschaftsbedingungen nicht erfüllst. Diese für Organisationen wesentliche, da überlebenswichtige Möglichkeit ist jedoch in Zeiten des Fachkräftemangels gesondert zu betrachten.
Das vierte Merkmal, die Existenz von und die Beständigkeit der Organisationsgrenzen, verdeutlicht, dass es ein „Innen“ und ein „Außen“ von Organisation gibt. Dieses „Innen“ und das „Außen“ zeigt sich bspw. dann, wenn Du Dir vorstellst, dass irgendjemand in Deiner Organisation vorbeikommen würde und heute mal gerne mitarbeiten würde. Selbst in Zeiten massiven Fachkräftemangels ist dies nicht (so einfach) möglich. Ebenso absurd ist die Vorstellung, dass die Hochschule ihre Organisationsgrenzen mal eben so verlässt und neben der Lehr- und Forschungstätigkeit eine Bäckerei eröffnet.
Warum es gut ist, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen
Dass sich Organisationen darüber definieren, dass sie sich zur Umwelt abgrenzen, einen oder mehrere Zwecke verfolgen, im Gegensatz zu bspw. Familien eine formale Struktur aufweisen und Mitgliedschaftsbedingungen formuliert sind, ist vielleicht wenig überraschend.
Überraschender ist da schon die Feststellung, dass das soziale System Organisation aus Perspektive der Systemtheorie nicht „aus Menschen“ besteht, sondern besser verstanden werden kann „als ein Netzwerk von fortlaufenden Entscheidungen“ (Richter, Groth, 2023, 125). Oder kurz:
Organisationen bestehen aus Entscheidungen, die in den formalen und informalen Strukturen der Organisation (teilweise schriftlich, teilweise mündlich) manifestiert sind. So ist schon die Gründung einer Organisation eine Entscheidung. Dann folgen weitere Entscheidungen (bspw. die Entscheidung, Personal einzustellen; die Entscheidung für den Zweck der Organisation; für die in der Organisation geltenden Regeln). Durch die ersten Entscheidungen ist ein Prozess des Entscheidens in Gang gekommen. „Jede Entscheidung impliziert weiteren Klärungs- und Handlungsbedarf, die entstehende Historie von bereits getroffenen Entscheidungen erfordert und beschränkt weitere Entscheidungen“ (ebd., 126).
Dass Organisationen nicht aus Menschen, sondern aus Entscheidungen bestehen, wirkt auf den ersten Blick „unmenschlich“. Aber wenn man versucht, den Menschen (im Sinne der Mitarbeiter:innen) „aus dem Mittelpunkt“ der Organisation zu nehmen, ergeben sich enorme Vorteile für das Be- und Verstehen von Organisationen ebenso wie für das Menschliche.
Der Vorteil für die Organisationen wird deutlich, wenn Du Dir mal eine Organisation vorstellst, in der die Mitarbeitenden in ihrer Ganzheit wirklich im Mittelpunkt stünden: Bei jedem Weggang von Menschen aus der Organisation – aufgrund von Kündigung oder aufgrund des Alters – entstünden Lücken, die niemals von anderen Menschen gefüllt werden könnten, da Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit nun mal sehr verschieden und damit nicht ersetzbar sind. Mehr noch: Wenn Organisationen um einzelne Menschen herum gebaut werden (was bspw. bezogen auf Gründer:innen von Start-Ups zu beobachten ist), „wird damit auf der Personenseite die Illusion genährt, dass die Organisation sich um die eigenen Anliegen und Wünsche herum entwickelt – d. h. die Organisation tritt in den Dienst der Bedürfnisse ihrer Beschäftigten. Diese Illusion hat katastrophale Auswirkungen auf die Organisation“ (Wimmer, 2019).
Katastrophal wird es für die Organisation vor allem dann, wenn nach Weggang einer oder mehrerer Personen ihr Überleben gefährdet ist. Anstatt also als „ganzer Mensch“ Teil der Organisation zu werden, übernehmen Menschen Rollen in der Organisation. Sehr einfach ausgedrückt wird man nicht als „Klaus“ oder „Claudia“ eingestellt, sondern – hoffentlich unabhängig vom Geschlecht – in der Rolle als „Sozialarbeiter:in“.
Die Vorteile der Trennung von Mensch und Rolle für die Mitarbeitenden ist nicht ganz so offensichtlich. Aber wenn man genau hinschaut, können über die Möglichkeit, Mensch und Rolle zu trennen, zum einen die in der Rolle formal formulierten und damit zu erfüllenden Anforderungen in den Blick genommen werden und zum anderen – getrennt von der Rolle – der Mensch. So kannst Du als Teamleitung gemeinsam mit Deinem Mitarbeitenden – bspw. in einem Mitarbeitergespräch – überlegen, ob und wie es gelingen kann, trotz der Herausforderungen, die zum Beispiel durch die Betreuung der eigenen Kinder (Perspektive Mensch) entstehen, mit den Anforderungen an seine Arbeit zu verbinden (Perspektive Rolle). Denkbar wäre, das ihr gemeinsam die in der Rolle formulierten Aufgaben an die Anforderungen anpasst, die von dem Mitarbeitenden erfüllt werden können. Denkbar wäre auch, eine andere Rolle für den Mitarbeitenden im Team bzw. der Organisation zu finden. Du hinterfragst dann eben nicht den Menschen als Ganzes, sondern versuchst, die Anforderungen der Rolle an die Möglichkeiten Deines Mitarbeitenden anzupassen.
Diese eher nüchterne Sicht der Trennung von Mensch und Rolle ist ein Gegenentwurf zur Ganzheitlichkeit und der oftmals zu hörenden Forderung, dass doch der „ganze Mensch“ in die Organisation einbezogen werden sollte. Und selbst Frederic Laloux (Autor von Reinventing Organizations) sieht ein, dass „it is a challenge for any organization to create an environment where people feel safe to show up whole“ (Laloux, 2014, 151).
Die drei Seiten einer Organisation
In den Ausführungen oben ist einmal das Wort Informalität gefallen. Was ist denn darunter zu verstehen? Das wird bei den drei Seiten einer Organisation deutlich.
So lässt sich jede Organisation – wenn man den Ausführungen von Kühl und Muster (2015, 17ff) folgt – anhand der Schauseite, der informalen und der formalen Seite beschreiben.
Die Schauseite
Die Schauseite meint die auch von außen sichtbaren Fassaden, die die Organisation öffentlich sichtbar darstellen will. Das sind zum Beispiel der Internetauftritt, die Veröffentlichung von Jahresberichten, von im Netz zugänglichen Leitbildern, aber auch die von außen sichtbaren Gebäude und öffentlich zugänglichen Bereiche einer Organisation. Da ich diese Zeilen gerade in einem Hotel schreibe: Der Blick in das oftmals kaum einsehbare Büro hinter den Hotelrezeptionen dieser Welt (fast jedes Hotel hat hinter der Rezeption ein Büro) zeigt, dass der erste Eindruck, den die Rezeptionen (Schauseite) vermitteln sollen, nicht mit den organisationalen Realitäten der Hotels übereinstimmen. Und vielleicht zeigt sich gerade in Hotels, dass die „Fassaden (…) eine Schutzfunktion [haben]: Sie dienen dazu, den Außenstehenden den Einblick zu verwehren, um in Ruhe Entscheidungen vorbereiten zu können, mögliche Konflikte vor der Außenwelt zu verbergen oder Fehler und Peinlichkeiten zu verheimlichen“ (ebd.). Für den Beitrag hier ist die Schauseite irrelevant, obwohl sie auch in sozialen Organisationen eine große Bedeutung hat.
Die formale Seite
Die formale Seite der Organisation oder kürzer: die Formalstruktur meint dann all das, was in der Organisation als „Mitgliedschaftsbedingungen“ offiziell entschieden wurde. Darunter fallen bspw. Anwesenheitszeiten, die zu erledigenden Aufgaben, die einzuhaltenden Prozesse, wer einem was sagen darf und wer nicht und so weiter. Formalstrukturen sind also all jene Entscheidungen, die in der Organisation entscheidbar sind und entschieden wurden und damit weitere Entscheidungen nach sich ziehen. In vielen Fällen sind diese Entscheidungsprämissen schriftlich niedergelegt, es reicht aber auch, wenn der:die Vorgesetzte eine Anweisung mündlich erteilt.
Die informale Seite
Anzunehmen, dass man eine Organisation einfach bis ins Kleinste „durchregeln“ könnte, wäre jedoch naiv (auch wenn das bspw. in Organisationskonzepten wie Holocrazy versucht wird). Denn „das Leben in der Organisation ist viel wilder, als es im schriftlich niedergelegten Regelwerk und den mündlich kommunizierten Anweisungen von Vorgesetzten zum Ausdruck kommt“ (Kühl, 2020, 25). Und damit sind wir bei der informalen Seite der Organisation. Mit der informalen Seite bzw. der Informalität der Organisation ist all das gemeint, worüber keine Entscheidung getroffen wurde – die nicht entschiedenen, aber entscheidbaren sowie die nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen. Informalität als Teil der Organisationsstruktur sind somit die nicht formal entschiedenen Handlungen, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten. „Erst wenn ein Deutungsmuster sich nicht nur bei einem einzigen Mitglied findet, sondern sich in Teilen der Organisation als erwartbar eingeschlichen hat, hat es den Status einer informalen Erwartung. Erst wenn die kurzfristige Abstimmung mit der Kollegin in der Nachbarabteilung nicht ausnahmsweise vorgenommen wird, sondern wiederkehrend als ‚kurzer Dienstweg‘ zur Abstimmung genutzt wird, hat man es mit einer informalen Struktur zu tun“ (ebd.). Diese Routinen und Gewohnheiten werden oft und etwas verkürzt als Organisationskultur definiert: „So machen wir das hier eben, damit es funktioniert“ oder auch „Das machen wir schon immer so!“
Nicht entschieden, aber entscheidbar ist häufig bspw. der Umgang mit Arbeitszeit in der Raucherpause. Hier wäre eine Entscheidung möglich, die aber nicht getroffen ist, wodurch es einerseits zu Unstimmigkeiten zwischen den Raucher:innen und den Nichtraucher::innen kommen kann. Hier wäre eine Festschreibung einfach möglich. Andererseits kann es durch die Regelung, dass Raucherpausen von der Arbeitszeit abgezogen werden, zu Folgeproblemen kommen: Wichtige Zeiten für informelle Absprachen gehen verloren. Deutlich wird, dass nicht alles Entscheidbare auch entschieden werden muss – im Gegenteil: Oftmals sind die nicht geregelten Freiräume hochgradig wichtig für das gute Funktionieren einer Organisation.
Und genauso wenig funktional ist es, jede Regelabweichung in einer Organisation automatisch zu sanktionieren. Denn viele (nicht alle!) Regelabweichungen sind für Organisationen hoch brauchbar (vgl. dazu näher Kühl, 2020a). Das gilt auch und insbesondere für Organisationen der Sozialen Arbeit.
Vier verschiedene Typen formaler Organisationsstrukturen
Wichtig ist, dass in Organisationen alle drei beschriebenen Seiten immer zusammenspielen. So hat eine Änderung der Schauseite (bspw. neue Homepage) ebenso Auswirkungen auf die informale Seite der Organisation wie die Zusammenlegung von Abteilungen. Einzig die „informale Seite“ selbst ist nicht unmittelbar entscheidbar. Vielmehr folgen die informalen Auswirkungen „wie ein Schatten“ den Entscheidungen auf den beiden anderen Seiten bzw. insbesondere den auf der formalen Seite getroffenen Entscheidungen. So hat zwar die Veröffentlichung von einem Leitbild Auswirkungen auf das Verhalten von Mitarbeiter:innen. Diese Auswirkungen werden aber viel weniger unmittelbar sein, als die Auswirkungen auf das Verhalten durch eine von der Vorgesetzten getroffenen Dienstanweisung zur ausschließlichen Nutzung der neuen Präsentationsvorlage – auch wenn diese von nicht allen Mitarbeiter:innen als „schön“ bewertet würde.
Zur Reduktion der Komplexität messe ich den auf der Schauseite möglichen Entscheidungen weniger Bedeutung bei. Davon habe ich zu wenig Ahnung. Wichtiger ist aber, dass auch die Entscheidungen auf der Schauseite in der Regel durch Entscheidungen auf der formalen Seite beeinflusst werden. So ist bspw. die Entscheidung, ein neues Leitbild zu erstellen, zunächst eine formale Entscheidung, die dann Auswirkungen auf die Schauseite der Organisation hat. Aber etwas strukturierter:
Wenn man den Ausführungen von Kühl und Muster folgt (vgl. 2016) können Organisationen über drei „grundlegend verschiedene Typen von Organisationsstrukturen – oder systemtheoretisch ausgedrückt: von Entscheidungsprämissen“ entscheiden:
- Programme,
- Entscheidungswege und
- Personal.
Programme:
Programme legen fest, „was man in einer Organisation tun darf und was nicht“ (ebd.). Sie lassen sich untergliedern in a) Konditionalprogramme und b) Zweckprogramme.
„Konditionalprogramme legen fest, was getan werden muss, wenn in einer Organisation ein bestimmter Impuls wahrgenommen wird“ (ebd.). Kurz kann man auch sagen: Alle vorgegebenen und verschriftlichten Prozesse (‚Wenn X passiert, ist Y zu tun!‘) sind Konditionalprogramme.
Zweckprogramme legen demgegenüber fest, „welche Ziele oder Zwecke erreicht werden sollen“ (ebd.). Hier geht es darum, was erreicht werden soll. Das kann auf Ebene der Gesamtorganisation entschieden werden. Wichtig ist aber auch, den Zweck bzw. die Zwecke der einzelnen Einheiten, Teams und Bereiche einer Organisation in den Blick zu nehmen unter der Frage: „Wozu sind wir da?“ Die Mittel und genauen Wege jedoch, wie der Zweck erreicht werden soll, werden in den Zweckprogrammen nicht näher definiert. Es werden damit keine Prozesse beschrieben, wie genau das Ziel bzw. der Zweck zu erreichen ist.
Entscheidungswege:
Entscheidungswege zeigen sich in den Organigrammen der Organisation und sagen aus, wer wem etwas sagen bzw. entscheiden kann, ohne dass dies angezweifelt wird. Hierarchien, Mitzeichnungsrechte oder auch die Kommunikationswege in Projekten, die sich temporär ausbilden, lassen sich als Beispiele für Entscheidungswege anbringen.
Personal:
Organisationen können darüber entscheiden, wen sie einstellen und wen nicht bzw. wen sie entlassen und wen nicht. „Jeder Beobachter kann feststellen, dass in Organisationen nicht nur über Personal entschieden wird, sondern dass Personalentscheidungen wichtige Prämissen für weitere Entscheidungen in der Organisation sind. Es macht für künftige Entscheidungen einen Unterschied, welche Person die für die Entscheidung zuständige Stelle besetzt“ (ebd.)
Hier kommt dann auch die Haltung, das Mindset, die Persönlichkeit der Menschen wieder ins Spiel – wenn, ja wenn Auswahlmöglichkeiten für die Besetzung einer Stelle zur Verfügung stehen. Da dies jedoch zunehmend weniger der Fall ist, gewinnt eine sinnvolle und damit funktionale Gestaltung insbesondere der Konditionalprogramme eine zunehmend wichtige Bedeutung.
Zusammenfassend lassen sich „Programme, Kommunikationswege und Personal (…) als Sinnbild für die Formalstruktur einer Organisation interpretieren. Über diese Entscheidungsprämissen können Leitungskräfte in Einrichtungen der Sozialen Arbeit entscheiden und hierdurch – im Sinne von Steuerung – Einfluss auf zukünftige Entscheidungen nehmen“ (Gesmann, Merchel, 2021, 37)
Über alles weitere, über die Strukturtypen Programme, Entscheidungswege und Personal hinausgehende und damit auch über die Informalität kann nicht formal entschieden bzw. aktiv gestaltet werden. Kurze Dienstwege oder neue Ideen können nicht angeordnet oder strukturell verankert werden ebensowenig wie der regelmäßige Besuch der Currywurstbude zur Mittagspause oder das „agile Mindset“ der vorhandenen Mitarbeiter:innen.
Was sind Organisationen – Zusammenfassung
Auch wenn mir bewusst ist, dass für eine Betrachtung von Organisationen als soziale Systeme noch viel mehr Aspekte zu berücksichtigen sind, um sie in ihrer Ganzheit zu verstehen, hoffe ich, hiermit so etwas wie die Basics zusammengeführt zu haben. Der Beitrag dient damit zum einen dazu, Grundideen dessen, was ich immer wieder in Fort- und Weiterbildungen rund um Fragen der Organisationsentwicklung vermittle, zusammen zu fassen. Zum anderen hoffe ich, damit auch einen Beitrag zur Steigerung des nicht unbedingt ausgeprägten Organisationsbewusstseins für Menschen im Gesundheits- und Sozialwesen zu leisten. Dieses Organisationsbewusstsein wird aufgrund der spezifischen Herausforderungen und der Besonderheiten, die Organisationen der Sozialen Arbeit aufweisen, in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Hier reicht allein der Gedanke an den Fachkräftemangel und die damit einhergehenden Notwendigkeiten der Neu- und Umgestaltung der formalen Strukturen der Organisation.
Und jetzt freue ich mich, von Dir zu hören und zu lesen, welche weiteren Aspekte beim Blick auf Organisationen zu berücksichtigen sind. Schreib‘ dazu doch gerne hier in die Kommentare, per Mail oder in den sozialen Medien. Freu mich drauf und Danke schon jetzt!
Quellen:
- Epe, H. (2022): Dominierende Informalität, oder: Warum sich soziale Organisationen so schwer entwickeln lassen. URL: https://www.ideequadrat.org/dominierende-informalitaet/. Download am 15.11.2023.
- Gesmann, S., Merchel, J. (2019): Systemisches Management in Organisationen der Sozialen Arbeit: Handbuch für Studium und Praxis. Erste Auflage. Systemische soziale Arbeit. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Göpel, M. (2022): Wir können auch anders: Aufbruch in die Welt von morgen. Berlin: Ullstein.
- Kühl, S., Muster, J. (2016): Organisationen gestalten: eine kurze organisationstheoretisch informierte Handreichung. Management kompakt. Wiesbaden: Springer VS.
- Kühl, S. (2020): Organisationen. Eine sehr kurze Einführung. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
- Kühl, S. (2020a): Brauchbare Illegalität. Weswegen sich Regelabweichungen in Organisationen nicht vermeiden lassen. Working Paper 4/2020. URL: https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/soziologie/fakultaet/personen/kuehl/pdf/Kuhl-Stefan;-Working-Paper-4-2020-Brauchbare-Illegalitat-Weswegen-sich-Regelbruche-nicht-vermeiden-lassen.pdf. Download am 05.09.2023.
- Laloux, F. (2014): Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Brüssel: Nelson Parker.
- Spiegel, Hiltrud von (2008): Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis. München.
- Richter, T., Groth, T. (2023): Wirksam Führen Mit Systemtheorie : Kernideen Für Die Praxis. Erste Auflage. Carl-Auer Verlag; 2023.
- Wimmer, R. (2019): Agilität, Ambidextrie und organisationale Veränderungskompetenz. Rudi Wimmer über Erbe und Zukunft des Change Managements. Gr Interakt Org 50, S. 211–216, 2019. https://doi.org/10.1007/s11612-019-00458-0.







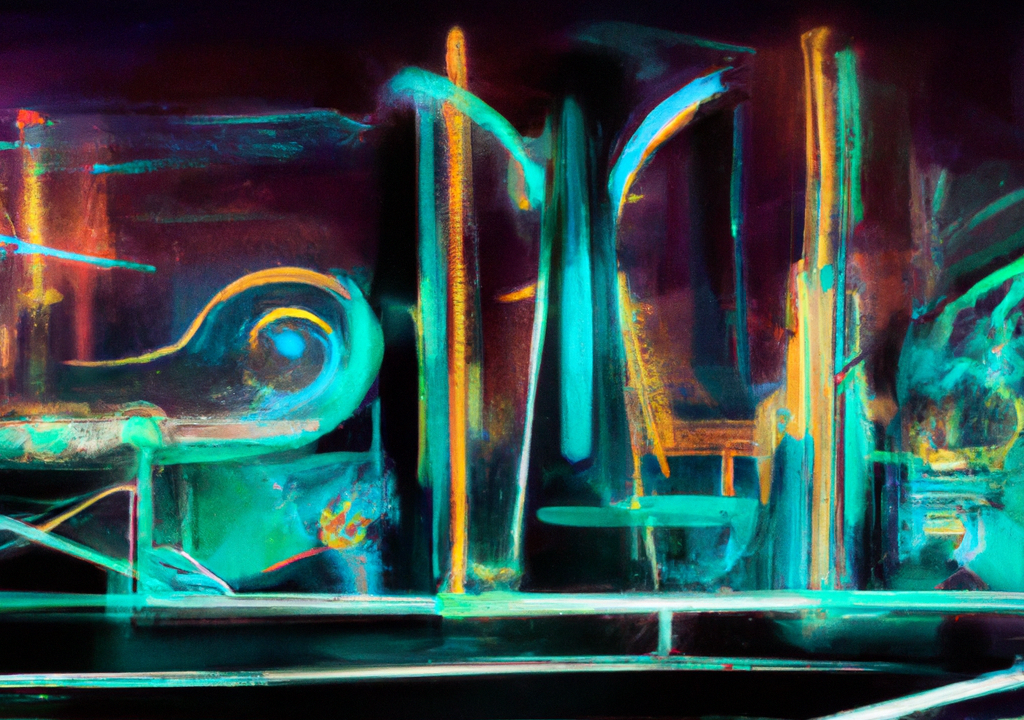

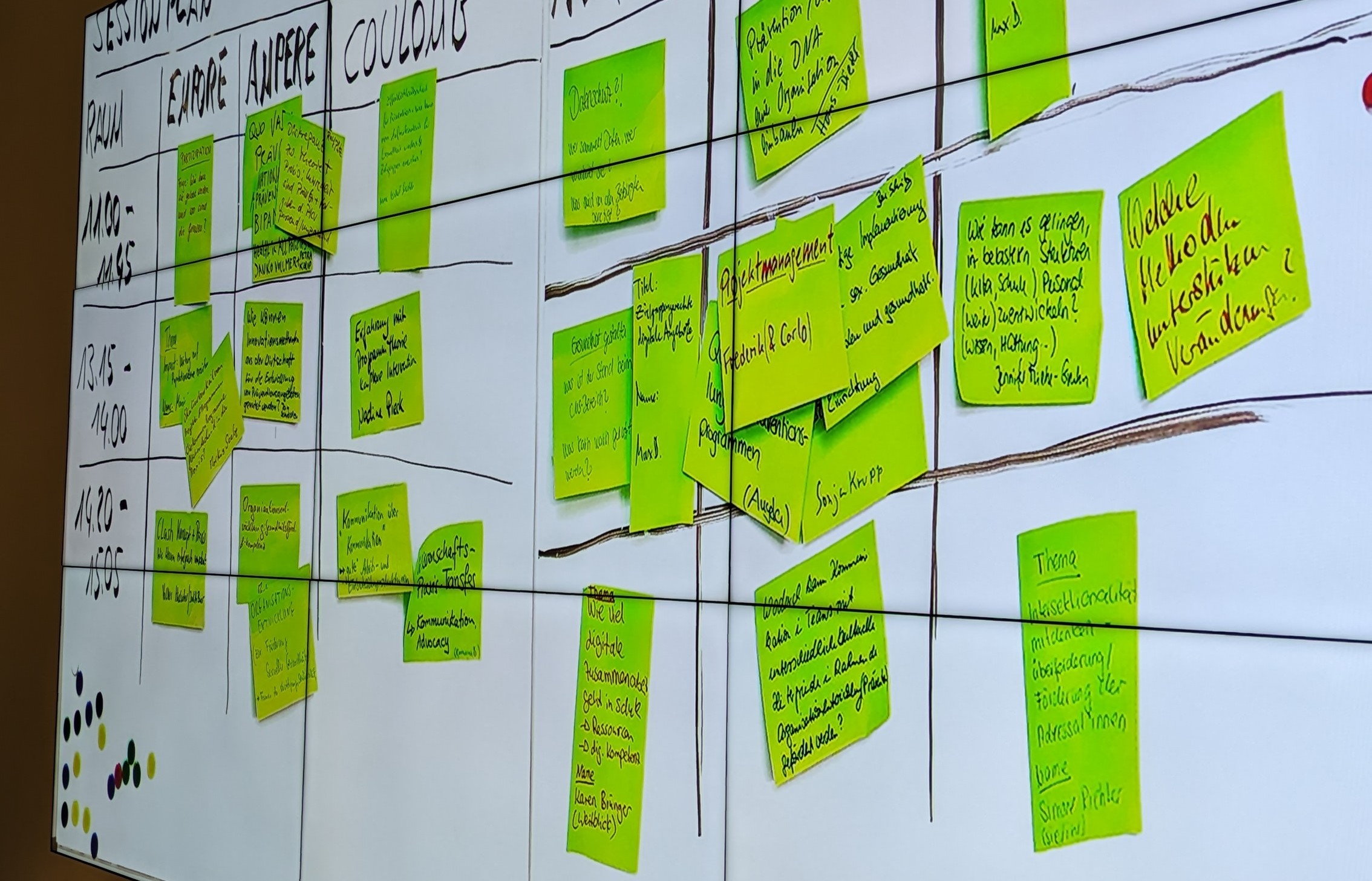




Neueste Kommentare