Beim Blick auf Lernen sind (mindestens) zwei Ebenen wichtig: die individuelle Ebene ebenso wie die organisationale Ebene (inkl. Ebene der Teams) des Lernens. Und gerade in der Sozialen Arbeit und in sozialen Organisationen sind wir darauf angewiesen, in Zeiten der Veränderung (VUCA-Blabla…) dringend neu, anders und weiter zu lernen. Hier kommt „New Learning“ ins Spiel, denn:
Das Lernen im Kontext von Dynamik und Komplexität funktioniert schon lange nicht mehr wie das aus Schule und Studium bekannte Lernen. Organisationales und individuelles Lernen wandelt sich radikal.
Aber der Reihe nach:
Im Beitrag erfährst du, was New Learning ausmacht, warum New Learning auch für Menschen in und für soziale Organisationen als Ganzes wichtig ist und wie Du (erste) konkrete Ansätze von New Learning für Dich und in Deiner Organisation umsetzen kannst.
Studien zur Situation der Personalentwicklung in Organisationen der Sozialen Arbeit sind spärlich gesät. Konkret die Frage, wie Lernen in unserer Branche stattfindet, welche Programme angeboten werden und welche Wirkungen was hat (auch wenn das nicht ganz einfach zu erfassen ist) lässt sich kaum beantworten. Das hat viele Gründe.
Eine sehr allgemein gehaltene These lautet, dass „Lernen“ in sozialen Organisationen nicht unbedingt einen großen Stellenwert hat. Stefan Gesmann von der FH Münster schreibt schon 2014, dass „die betriebliche Weiterbildung in Einrichtungen der Sozialen Arbeit oftmals nur unzureichend in das Managementhandeln von Leitungskräften eingebunden ist“. Und gemeinsam mit Berthold Dietz von der EH Freiburg habe ich beschrieben, „warum wir verpflichtende Weiterbildung in der Sozialen Arbeit“ brauchen.
Kurz: Hier ist viel Luft nach oben und einiges an Forschung und Entwicklung vonnöten.
Was ist New Learning?
Ich habe das Buch „New Work braucht New Learning – Eine Perspektivreise durch die Transformation unserer Organisations- und Lernwelten“ von Jan Foelsing und Anja Schmitz gelesen.
Falls Du Dich näher für das Buch oder meinen Eindruck zum Buch interessierst, findest Du hier eine ausführlichere Rezension auf dem Blog (und hier bei socialnet.de). Jedenfalls beziehe ich mich inhaltlich bei vielen Aspekten auf das Buch und ergänze die Ideen um spezifische Fragestellungen sozialer Arbeit und sozialer Organisationen.
Der Ansatz „New Learning“ versucht, die Herausforderungen der Veränderungen der Arbeitswelt und die Prinzipien von New Work (darauf ließe sich wiederum vertieft eingehen) mit der Frage zu kombinieren, wie wir als Individuen und als Organisationen jetzt und in Zukunft sinnvoll lernen.
Dabei steht ein Wechsel von tayloristisch geprägten, top-down organisierten und vorgegebenen Lernsettings hin zu zu bedürfnisorientierten, dynamik-komplexitätsrobusten, kollaborativen Lernökosystemen an, so die Autor*innen des Buchs. Lernen wird damit ein möglichst aktiver und sozialer Prozess, der bedürfnis- oder problemorientiert an echte Herausforderungen gebunden ist. Ziel ist, eine echte Verhaltensänderung herbeizuführen (vgl. ebd., 107).
Aktiv und sozial sind die wesentliche Stichworte:
Aktiv bedeutet, dass New Learning selbst gesteuert ist und sozial bedeutet, dass Lernen eingebunden in unterschiedlichste Netzwerke erfolgt. Hier liegen die wesentlichen Unterschiede zum „old learning“, wenn man diesen Begriff bemühen will:
Old learning basiert auf vorgegebenen, oftmals durch die eigene Organisation strukturierten Lernsettings. Diese von der Organisation angepriesenen „Fortbildungskataloge“, in denen Angebote aufgeführt sind, die niemand bucht, kennt wahrscheinlich jede*r von Euch, oder? Und wenn die Angebote gebucht werden, geht es vornehmlich um die Pausen, in denen man Menschen trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.
New Learning hingegen basiert auf der selbstgesteuerten, autonomen Gestaltung der eigenen Lernsettings wie auch der benötigten Lerninhalte. Und das Ganze findet dann eben noch eingebunden in analoge, hybride und/oder rein digitale Netzwerke statt.
Für mich ist das im Übrigen einer der wesentlichen Gründe, in den sozialen Medien aktiv zu sein:
Hier leben meine ganz individuellen Lernplattformen, meine Netzwerke und Communities (dickes Danke an dieser Stelle). Dabei geht es viel weniger um das reine Nutzen der Inhalte und Ideen der dort aktiven und weniger aktiven Menschen. Es geht um die co-kreative Gestaltung von neuen Ideen.
So kreiere ich meine Lernprozesse orientiert an meinen Bedarfen basierend auf unterschiedlichen Methoden als „Remix vielfältiger interner und externer Inhalte sowie im Austausch und co-Kreation mit [m]einen Learning Peers, selbst.“ (ebd., 108).
An dieser Stelle will ich nicht tiefer auf die neuen Lernmethoden eingehen, die genutzt werden können, um Kompetenzen für die Zukunft, sog. Future Skills, zu generieren. Es würde ausufern, hier Methoden von Working out loud #WOL über ambidextres Lernen bis hin zu Value-creation oriented Learning (VOL) zu beschreiben. Diese Methoden lassen sich bspw. im genannten Buch oder im Netz finden.
Wichtiger ist mir die Betonung, dass effektives Lernen von Individuen wie von Organisationen heute schon und in der Zukunft verstärkt zum einen zum zentralen Wettbewerbsvorteil wird (vgl. ebd., 160).
Zum anderen aber, und das finde ich noch relevanter, brauchen wir neue Lösungen für die gesamtgesellschaftlichen und auch globalen Herausforderungen der Zukunft. Diese Lösungen können wir nur durch Innovationen auf allen Ebenen und damit durch gemeinsames Neu- und Anders-Lernen gestalten, die, wie Scharmer schreibt, „die Fähigkeit zum gemeinsamen Spüren und zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft aufbauen“ (hier).
Auswirkungen von New Learning auf soziale Organisationen
Gibt es strukturierte Lernmöglichkeiten in Deiner Organisation?
Falls dem so ist, arbeitest du in einer Einrichtung, die nicht dem Standard entspricht. So lässt sich zwar konstatieren, dass soziale Organisationen, Non-Profits oder auch Organisationen der Sozialen Arbeit sehr personalintensiv sind, da die Leistungserbringung fast immer auf interpersonellen Austauschprozessen basiert.
Daraus folgt, dass die Menschen in den Organisationen wichtigste Ressource zur Wertschöpfung und gleichzeitig größter Kostenfaktor sind. Hinzu kommt, dass der Fachkräftemangel in einigen Arbeitsfeldern sozialer Arbeit existenzbedrohende Ausmaße annimmt.
Gerade unter diesen Bedingungen wäre es mehr als notwendig, effizient und effektiv, wenn Menschen ihre Kompetenzen bestmöglich einsetzen könnten. Denn die Mitarbeiter*innen sozialer Organisationen sind *die* strategisch wichtige, unverzichtbare Ressource (wenn man das so nennen will) zur Erreichung der Wertschöpfung der Organisationen (vgl. näher bspw. Englert, B. 2019, Personalmanagement in Nonprofit-Organisationen, S. 1).
Allein vor dem Hintergrund dieser minimalen Skizze ist es verwunderlich, dass der Personalentwicklung bislang so wenig Raum in sozialen Organisationen eingeräumt wird. Ja, I know, es ist keine Zeit und kein Geld da, aber der Waldarbeiter mit seiner ungeschärften Säge sollte uns warnendes Beispiel sein.
Mehr noch aber können Ansätze des New Learnings helfen, Lernen und Entwicklung und damit Innovation gerade in den hoch komplexen und anspruchsvollen Arbeitsbedingungen sozialer Arbeit unter Bedingungen begrenzter Ressourcen zu realisieren.
So geht es bei New Learning – der obigen Definition folgend – um das bedürfnis- und problemorientierte, selbstbestimmte Lernen, das an echte Herausforderungen gebunden ist. Beim New Learning geht es nicht mehr um die langweilige Weiterbildung, die in einem muffligen Keller-Raum der 60er Jahre („Das ist unser neues Innovation Lab, Steve Jobs hat auch so angefangen…“) verpflichtend abgehalten wird.
Es geht um die Frage, wer was – welche Inhalte, welche Verbindungen, welche Kontakte, welches Wissen, welche Ideen – zu welchem Zeitpunkt wofür braucht. Damit rücken gießkannenartige Weiterbildungskonzepte in den Hintergrund. Dem spezifischen, Problem-orientierten, individuellen Weg wird Vorrang eingeräumt.
Konkret ist dann nicht mehr der Master-Studiengang XY für die angehende Führungskraft sinnvoll, um „einmalig alles“ zum Thema zu erfahren, sondern peu a peu werden über ausgewählte Learn-Nuggets oder Micro-Learnings die für die neue Aufgabe wirklich benötigten Kompetenzen erworben.
Dieses Lernen erfolgt während bzw. parallel zur Arbeit und schont damit auch die Ressourcen, die sonst für ein langwieriges Bildungsprogramm aufgewendet worden wären (ich komme unten noch mal dazu, warum trotz aller Veränderung die traditionellen Programme ihre Berechtigung haben).
Wichtig im New Learning sind demzufolge zwei Dinge:
a) Es braucht eine grundlegende Kompetenz, selbstbestimmt und autonom lernen zu können (und zu wollen).
Und b) braucht es „Content Curation“, also die Aufbereitung und Zusammenstellung der unüberschaubaren Menge von (meist) frei verfügbaren Inhalten und die Begleitung der Menschen durch diese neuen Lernwelten.
Aus diesen beiden Aspekten folgt dann eine c) „New Learning Culture„, also eine Kultur, in der Lernen im Zentrum steht.
Kompetenz, selbstbestimmt zu lernen
Bei Punkt a) sehe ich einige Herausforderungen. So bereitet unser Bildungssystem im Kern nicht auf das selbstbestimmte, autonome Lernen vor, sondern verfolgt – verkürzt ausgedrückt – Prinzipien und Mechanismen, die vorhandenes Wissen in standardisierte und damit abprüfbare Einheiten unterteilen.
Hier sind wirklich gute Ansätze erkennbar, die jedoch vornehmlich von einzelnen, engagierten Menschen aus dem Bildungsbereich vorangetrieben werden. Systematische Veränderungen lassen – trotz Corona, Home-Schooling, Distance Learning… – seit etwa 60 Jahren auf sich warten. Das Bologna-System der Hochschulen hat übrigens nicht dazu beigetragen, hier auf akademischer Seite zeitgemäße Veränderungen herbeizuführen. Kurz: Lernen lernen muss man selbst lernen. Da ist viel Bedarf.
Content Creation
Und Punkt b) – Content Creation – ist in unserem Feld (ebenso wie in den meisten anderen Feldern) Neuland. Welches sind die „guten“ Inhalte, die Hand und Fuß haben? Wie komme ich daran, um meinen Bedarf jetzt zu decken? Warum ist es vielleicht nicht nur klug, meine Frage zum Thema XY in eine Facebook-Gruppe zu stellen? Wo kann man sonst noch schauen, um tiergehende Inhalte zu finden, die jetzt weiterhelfen? Wie baut man (s)eine Learning Community in und außerhalb der Organisation auf?
Diese und mehr Fragen sind oftmals unklar. Und gerade deshalb sind sie so wichtig – auch für die Soziale Arbeit.
Und noch einmal zu den Auswirkungen von New Learning (oder wie auch immer man das nennt…) auf soziale Organisationen insgesamt:
New Learning Culture
Ich bin davon überzeugt, dass sich für soziale Organisationen, die sich heute mit Fragen des Lernens von Morgen befassen und damit an ihrer eigenen Lernkultur arbeiten, enorme Wettbewerbsvorteile im Kampf um die besten Fachkräfte, vor allem aber echte Vorteile für ihre Klient*innen ergeben. Jan Foelsing und Anja Schmitz sprechen im Buch „New Learning“ von einer „New Learning Culture“, die sich zusammenfassend dadurch auszeichnet, dass
- dem Lernen ein hoher Stellenwert beigemessen wird, .
- kontinuierliches individuelles, team- und netzwerkorientiertes Lernen als zentral erachtet wird, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der anstehenden Veränderungen bewältigen zu können und
- Lernen hierbei als Basis für die nachhaltige Anpassungs-, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Organisation gesehen wird (vgl. ebd., 198).
Cool wäre manchmal wohl schon eine Learning Culture, ohne New…
Erste Schritte im New Learning, die Du direkt umsetzen kannst!
New Learning ist bzw. die Ideen hinter dem, wie wir in unseren Organisationen zukünftig mit Lernen umgehen werden, sind enorm umfangreich, komplex und vielfältig:
Vom Individuum angefangen über das Lernen im Team bis zur Organisation und den auf die Organisation einströmenden technologischen und gesellschaftlichen Anforderungen durch die Umwelt, in die die Organisation eingebunden ist, wird deutlich, dass neues Lernen ganzheitlich zu betrachten ist.
Das ist einerseits super, da auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt werden kann und Erfolge zu erzielen sind.
Andererseits ist es aber auch abschreckend, da überhaupt nicht klar ist, wo denn der beste „Hebel“ ist, an dem angesetzt werden kann. Das kann zum Erstarren oder dazu führen, einfach mal lieber nichts zu machen…
Und wo sind vor allem die Hebel, an denen Du „einfach“ ansetzen kannst, um weiter zu kommen?
Dazu hier ein paar Ideen:
Vision gestalten
Muhahaha…. Kleiner Schritt und wir beginnen wieder bei der Vision – also ganz oben?
Ja, aber mein Verständnis hier ist, dass Du die Vision auf alle angesprochenen Ebenen anwenden kannst: Auf die Organisation, Deine Abteilung und Dein Team und auf Dich selbst: Die Grundfrage lautet demnach:
- Wo willst Du (aka Dein Team, Abteilung, Organisation) hin?
- Wozu willst Du dich mit neuem Lernen beschäftigen?
Die Antworten darauf können sehr klein sein, aber das ist völlig passend: Die Intention, mit (neuem) Lernen zu beginnen, zählt – für Dich, Dein Team und Deine Organisation.
Exploitatives Lernen, oder: Herausforderungen identifizieren
Wo drückt der Schuh (wirklich)?
Die transparente Darlegung der aktuellen Herausforderungen, denen Du in der Arbeit auf individueller Ebene, auf Ebene der Teams und Abteilungen oder der Gesamtorganisation begegnest, zeigt Dir, wo wirklich Lernen angesagt ist, um zu neuen Ideen und Lösungen zu kommen.
Wenn klar ist, wo die Herausforderungen liegen, kannst Du Dich auf die Suche nach passenden Lern-Lösungen (vom YouTube-Video über Bücher, moocs und Blogs bis hin zu ganzen OE-Maßnahmen) machen.
Dieses Lernen lässt sich als „exploitatives Lernen“ definieren: „Exploitatives Lernen zielt auf Verbesserung der eigenen Kompetenzen, ihre möglichst effiziente Anwendung, sowie die Erweiterung, Verfeinerung oder Vertiefung von bereits bestehendem Wissen und Kompetenzen (…). Es geht also darum, die eigene Leistung im bestehenden Kontext möglichst schnell und kontinuierlich zu erhöhen, um die momentanen Aufgaben effizienter erledigen zu können“ (ebd., 111).
Lernen geschieht hier in der Absicht, bestimmte Lösungen zu generieren: Du hast ein Problem in Deinem aktuellen Arbeitskontext? Du brauchst eine Lösung in Deinem aktuellen Arbeitskontext!
Exploratives Lernen, oder: Lernen ohne Lösung
Was aber ist mit Lernen, das wirklich grundlegend Neues hervorbringt? Hier spricht man von „explorativem“, also dem entdeckenden Lernen: „Exploratives Lernen bezieht sich (…) auf die Erkundung von und das Experimentieren mit ungewohnten Kontexten und Fachgebieten, das Verlernen von Gewohntem, das sich Einlassen auf bisher „undenkbare“ Perspektiven, d. h. auf Lernen außerhalb der aktuellen Wissensdomänen. Dazu gehören Verhaltensweisen, wie z.B. suchen, variieren, experimentieren, spielen, oder entdecken, die ein tieferes Lernen ermöglichen“ (ebd.).
Die Herausforderung explorativen Lernens besteht darin, dass es nicht unmittelbar „nutzbar“ ist und trotzdem enorme Relevanz hat:
Ohne neue Ideen, ohne Innovation und wirkliche Entwicklung wird jede Organisation früher oder später in Schieflache geraten. Und trotzdem ist es nicht einfach, gegenüber Vorgesetzten die Notwendigkeit explorativen Lernens zu begründen.
Manche Arbeitgeber stellen ihren Mitarbeiter:innen 10% der Arbeitszeit zur vollkommen freien Verfügung bereit. In dieser Zeit können sich die Mitarbeiter:innen mit was auch immer beschäftigen und weiterbilden. Das sind optimale Bedingungen, um exploratives Lernen zu ermöglichen.
Deine Lernformate finden
Was sind Deine Lernformate? Diese Frage klingt trivial, ist aber mehr als wichtig: Bislang definierten wir Lernen in und für unsere Arbeitswelt und damit „Corporate Learning“ meist als staubig, trocken und in irgendwelchen Tagungshotels stattfindend – Wasser, Kaffee und Butterbrezeln inklusive.
Wenn „New Learning“ aber – wie oben definiert – ein möglichst aktiver und sozialer Prozess ist, der anhand Deiner Bedürfnisse bzw. Probleme echte Herausforderungen lösen will, ist es unabdingbar, dass Du Lernen für Dich in Deinen Formaten definierst. Die Formate können dabei komplett vielfältig sein:
- Blogs,
- Videos,
- Social Media,
- Podcasts,
- Barcamps,
- Bücher,
- Online-Kurse,
- Coachings,
- klassische Weiterbildungen,
- Formate wie Working out loud und ähnliche,
- …
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, flexibel und oftmals enorm kostengünstig. Was sind aber die für Dich geeigneten Formate, damit Du für Dich wirklich weiterkommst? Womit gelingt es Dir am Besten, Dein Bedürfnis bestmöglich zu erfüllen?
Die Beantwortung der Fragen setzt voraus, dass man sich mit diesen Themen befasst. Darin sehe ich leider ein immer noch großes Problem auch und gerade sozialer Berufe: Nein, nach dem Studium bist Du nicht „fertig“ mit Deiner Ausbildung. Ja, Du kannst immer noch Lernen und Dich verändern. Das musst Du aber wollen. Und – das ist die andere Seite – Du musst es (in Bezug auf Dein Arbeitsleben) dürfen. Deine Organisation muss Lernen aktiv zulassen. Leider ist auch das, wie schon gesagt, immer noch eine echte Herausforderung.
Fazit: New Learning ist (d)eine neue Welt
Es gibt noch drölfzig weitere Ansatzpunkte, „Dein“ und „Euer“ New Learning zu finden. Nicht berücksichtigt ist bspw. die Frage, welche technischen Voraussetzungen, aber auch welche technischen Unterstützungsmöglichkeiten denkbar und sinnvoll sind.
So ist dieser Beitrag in seiner ersten Fassung vor „ChatGPT“ entstanden. Die mit den LLMs einhergehenden Möglichkeiten für die Gestaltung von Lernen und Weiterbildung sind enorm.
New Learning ist – wie New Work – kein Programm, kein Rezept, nicht ein-, sondern vieldimensional und hochgradig spannend.
Denn eins ist sicher: Lernen verändert sich massiv. Dabei ist es ganz egal, ob Du jetzt den Begriff magst oder nutzt oder nicht.
Diese Veränderung ist aus meiner Sicht definitiv zu begrüßen:
Wenn Autonomie und Selbstbestimmung nicht nur als Prämissen für New Work, sondern auch als Prämissen für New Learning, also das Lernen der Zukunft, fungieren, kann es nur gut werden.
Lernen bedeutet dann nicht mehr, sich einmalig und verpflichtend oben Wissen reinzustopfen, das von außen aufbereitet und vorgegeben und noch abgeprüft und wieder vergessen wurde.
New Learning ist emotional, interessen- und fähigkeitengeleitet, an individuellen Anforderungen und Bedarfen orientiert. Das war (echtes) Lernen zwar schon immer, aber angesichts unserer Herausforderungen wird immer deutlicher, dass es klassisch nicht mehr geht. Somit:
Such Dir Netzwerke und Unterstützung und begib Dich auf Deinen Weg hin zum New Learning.
Aber, und das ist mir abschließend mit Blick auf soziale Organisationen wichtig:
Wir sehen eine Menge Menschen, die nicht „gelernt“ haben, wie sie neu Lernen können. Gerade in sozialen Organisationen haben wir es in vielen Fällen mit Menschen zu tun, die extrem negative Schul- und Lernerfahrungen gesammelt haben, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und die ganz grundlegende Schwierigkeiten in der Gestaltung des Lebens nach „unserer Normalität“ haben.
Soziale Organisationen sind dafür da, Menschen in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung zu unterstützen (vgl. Definition Sozialer Arbeit). Um dies auch auf Ebene des Lernens gewährleisten zu können, sind wir – die Professionellen in der Sozialen Arbeit – verpflichtet, uns mit neuen Wegen des Lernens zu befassen. Nur so kann es gelingen, die Klient*innen auf ihren „New Learning Wegen“ zu begleiten.
Ach, und noch was: Vielleicht sind die Lernwege der Klient *innen viel näher am New Learning als das, was wir mit unserer professionellen Brille als „richtig“ empfinden?
Dieser Beitrag ist für die „Blogparade I/V: #NewLearning – was kann „Radikal Neu“ jetzt auch für das LERNEN bedeuten?“ leicht überarbeitet und aktualisiert worden. Deswegen: #NewLearning / #NextLearning 😉

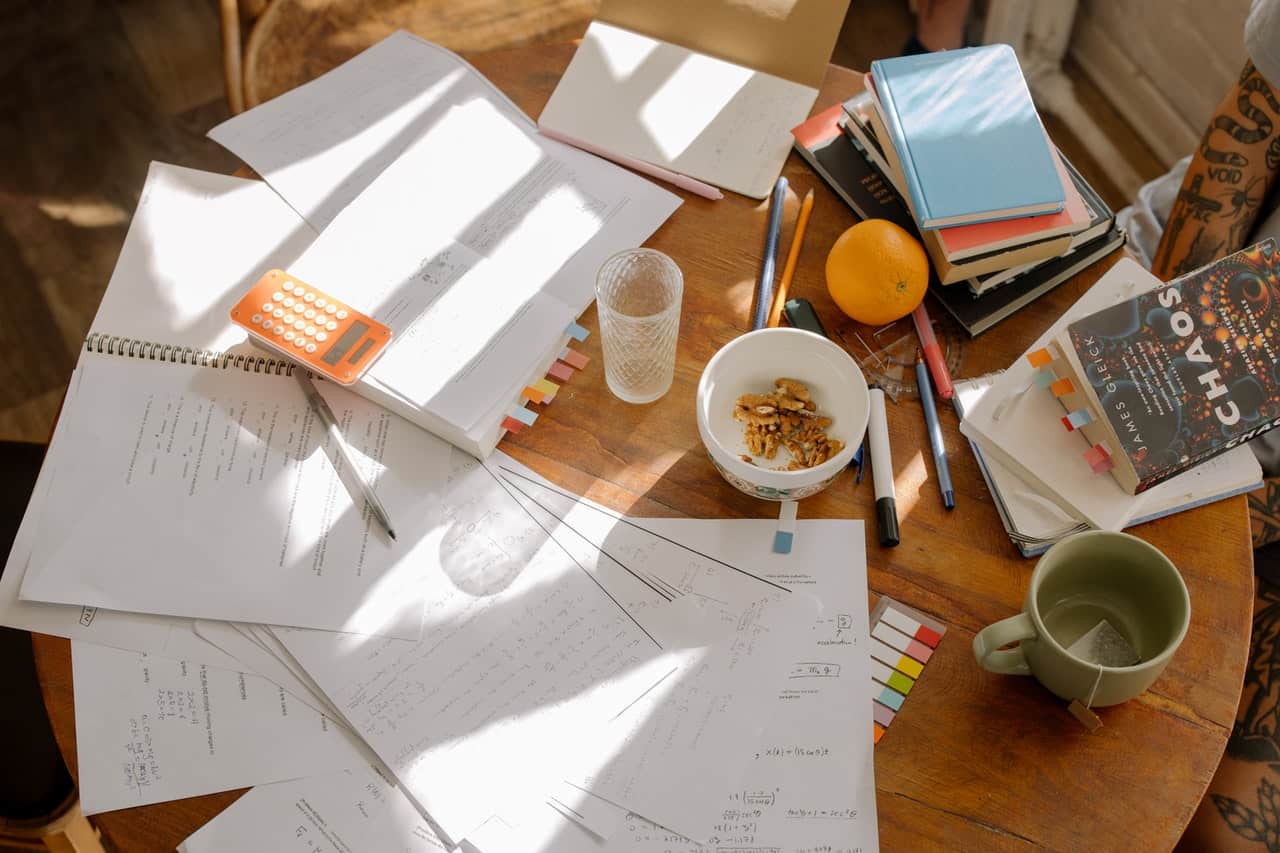


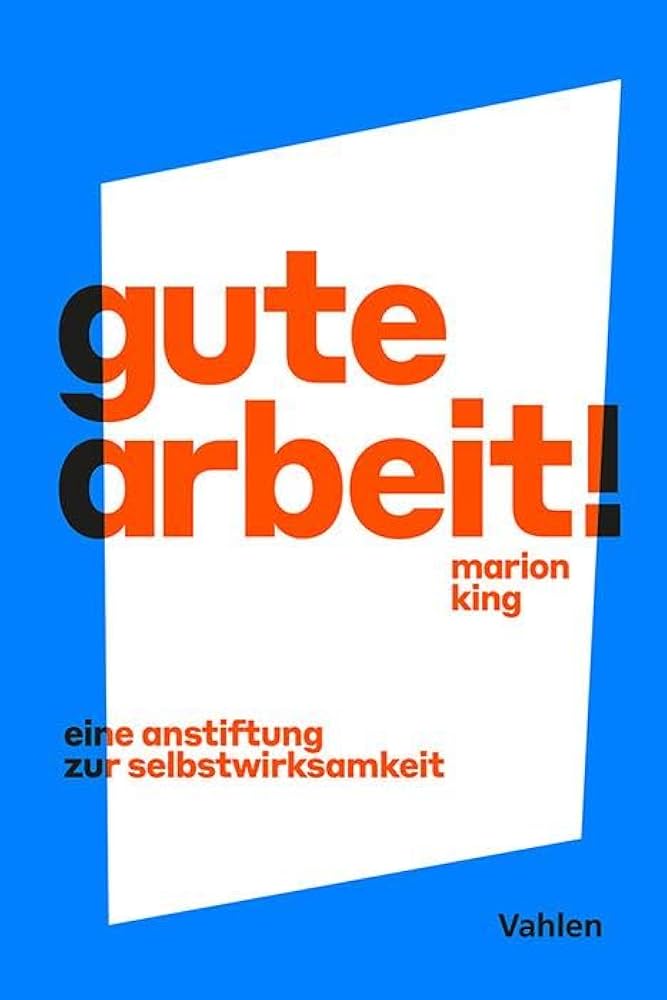






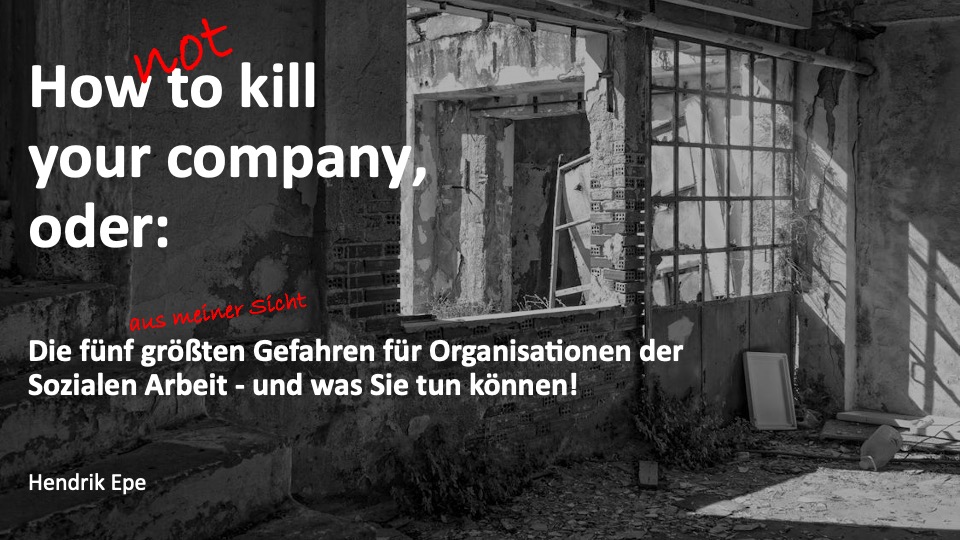

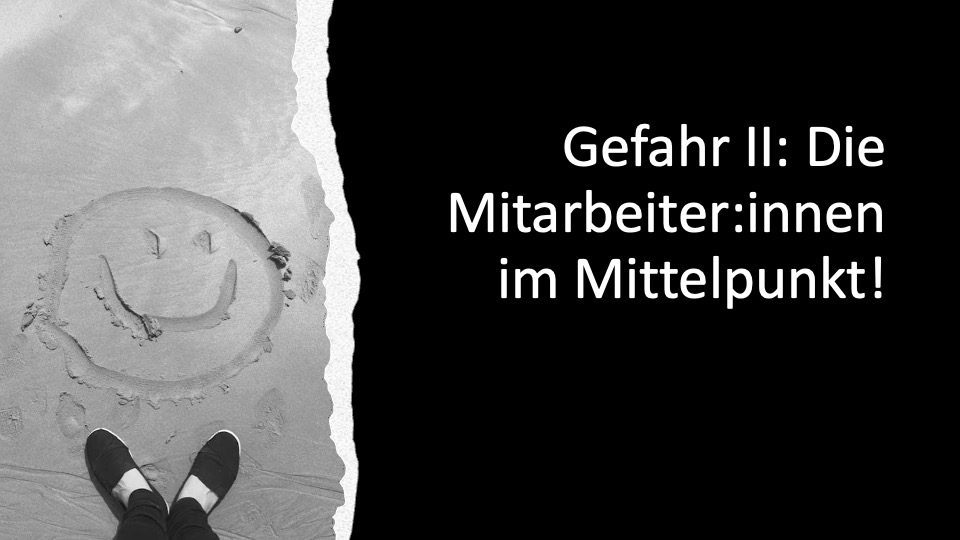
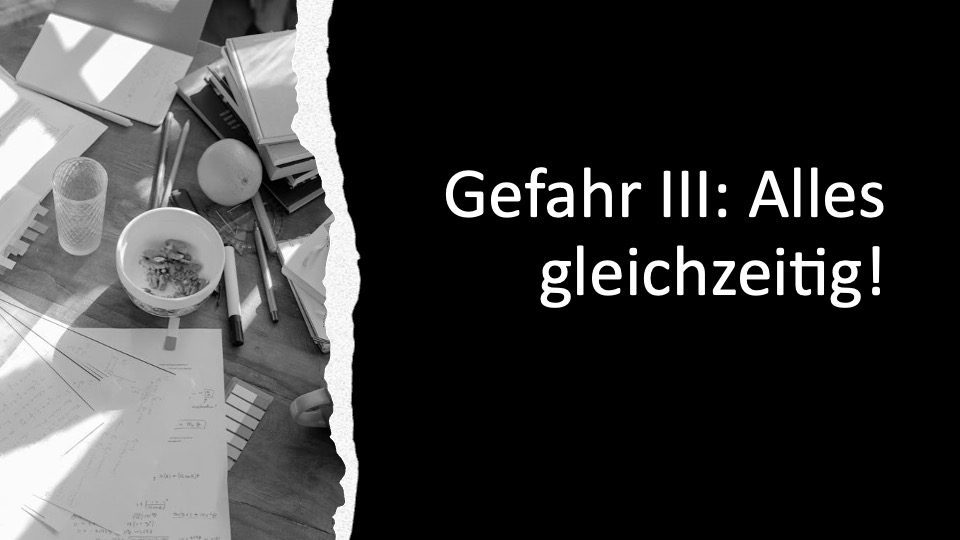
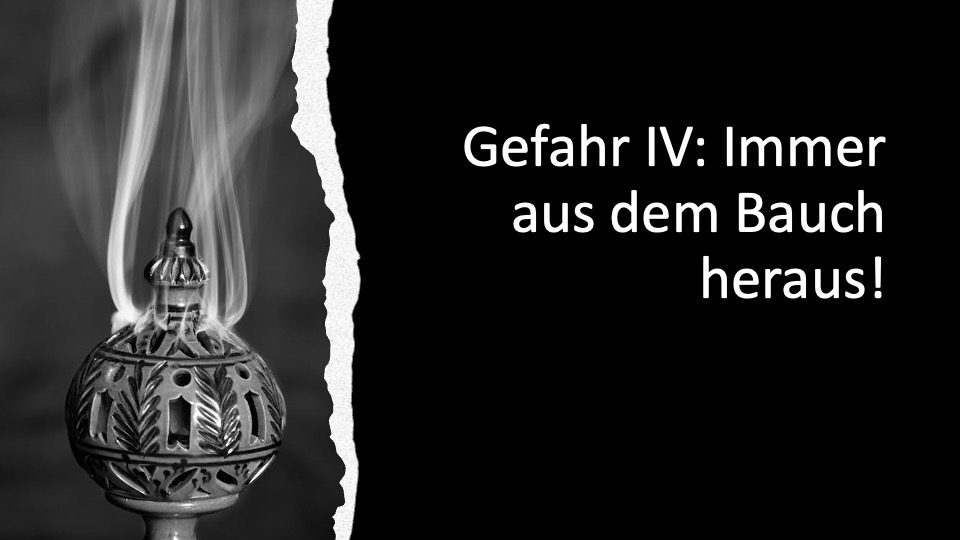
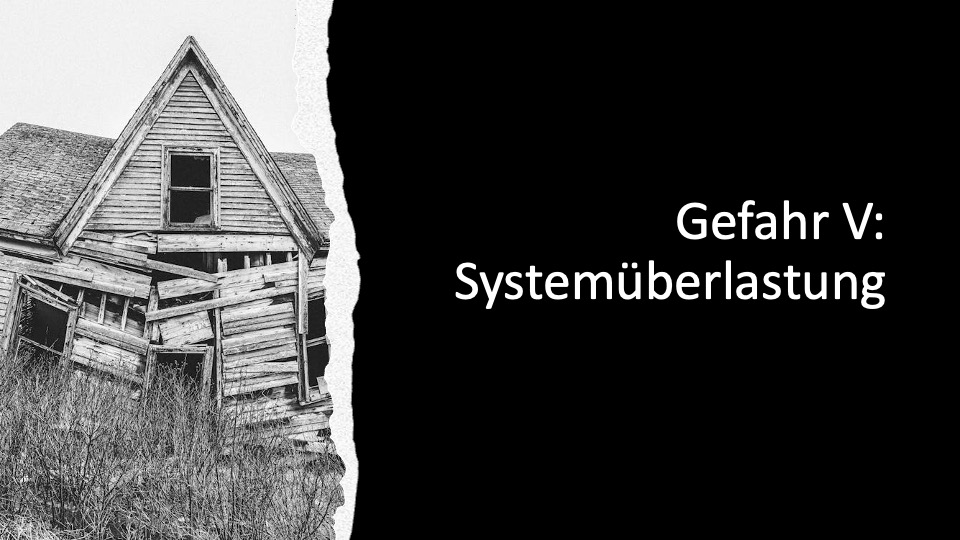
Neueste Kommentare