Wir brauchen die große Transformation – in unseren Organisationen, in der Gesellschaft und in der Welt. Die Notwendigkeit, der Klimakatastrophe zu begegnen, erfordert Veränderungen, die wir heute noch nicht absehen können. Diese – zumindest aus meiner Sicht – realistische und im wahrsten Sinne des Wortes radikale Perspektive erzeugt Widerstand. Sie ruft Lobbygruppen auf den Plan, die sich mit Händen und Füßen gegen Veränderungen wehren. Vermeintlich errungene Freiheiten werden auf keinen Fall aufgegeben. Mit aller Macht wird am Status quo festgehalten. Das kennen wir auch von Organisationen. Wie wäre es aber, wenn wir die Veränderungen sozialer Systeme (Organisationen, Gesellschaft…) mit den Möglichkeiten der Verhaltensänderung der Gewohnheiten psychischer Systeme (Menschen) vergleichen und daraus viele neue, kleine Wege zur großen Transformation finden? Die Veränderung der Gewohnheiten psychischer Systeme erfolgt selten durch große Umbrüche. Erfolgversprechender ist die Veränderung organisationaler Gewohnheiten, die dann langfristig zu großen Veränderungen führen. Wie die Veränderung organisationaler Gewohnheiten gelingt, beschreibe ich hier.
Gewohnheiten
Gewohnheiten können auf individueller Ebene als regelmäßige Verhaltensmuster definiert werden, die Menschen automatisch und unbewusst ausführen, ohne darüber nachzudenken. Gewohnheiten sind oft tief in unserem Unterbewusstsein verankert und werden durch wiederholtes Handeln gefestigt. Gewohnheiten können sowohl positiv als auch negativ sein und beeinflussen unser tägliches Leben auf vielen Ebenen, einschließlich unserer Gesundheit, Produktivität und Beziehungen. Beispiele für Gewohnheiten sind das Zähneputzen, das tägliche Training oder das Rauchen.
Organisationale Gewohnheiten sind regelmäßige Verhaltensmuster und Arbeitspraktiken, die sich in einer Organisation als „nicht entschiedene Entscheidungsprämissen“ etabliert haben und die Art und Weise beeinflussen, wie Arbeit erledigt wird.
Diese Gewohnheiten können sich auf verschiedene Aspekte einer Organisation auswirken, einschließlich der Arbeitskultur, der Effizienz, der Kommunikation und der Entscheidungsfindung.
Wie individuelle Gewohnheiten können auch organisatorische Gewohnheiten positive oder negative Auswirkungen haben. Sie können für die Organisation funktional oder dysfunktional sein. Und sie sind oft tief im „Unterbewusstsein der Organisation“ und damit in ihrer Kultur verwurzelt.
Beispiele für organisationale Gewohnheiten im Sinne nicht entschiedener Entscheidungsprämissen sind der Umgang mit regelmäßigen Besprechungen, das Befolgen bestimmter Arbeitsabläufe, obwohl diese nicht formal geregelt sind, oder das Treffen von Entscheidungen nicht auf der Basis von Daten und Fakten, sondern auf der Basis von „gefühlten Normen“.
Diese organisatorischen Gewohnheiten, diese Routinen in Organisationen entwickeln sich ständig weiter. Sie sind – wie gesagt – ein wesentlicher Bestandteil der Organisationskultur.
Für soziale Organisationen haben „organisationale Gewohnheiten“ im Sinne einer „dominierende Informalität“ eine besondere Bedeutung. Das habe ich hier beschrieben.
Veränderung organisationaler Gewohnheiten
Mein Selbstbild ist das eines Gewohnheitstiers. Oder anders gesagt:
Ich glaube, ich bin nicht gut darin, meine Gewohnheiten zu ändern, auch wenn ich weiß, dass sie nicht gut sind. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, sondern vielen Menschen. Denn – wie oben beschrieben – sind Gewohnheiten oft tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Gewohnheiten zu ändern kostet zudem Überwindung und gleichzeitig erzeugt jede Veränderung Unsicherheit. Also: Lieber entspannt weitermachen?
Oder noch besser: Gewohnheiten aus einer anderen Perspektive verändern:
Wer willst Du sein?
Clear erklärt in seinem Buch, dass es von grundlegender Bedeutung ist, sich bewusst zu werden, wer wir sein wollen, und erst danach die Gewohnheiten anzugehen. Es geht also um Identität, um den Kern unseres Seins, um unseren „purpose“.
„Jede Handlung, die du tust, ist eine Wahl darüber, was für ein Mensch du sein willst.“
S. 38
So macht es auf der individuellen Ebene einen großen Unterschied, ob ich Sport treiben möchte oder ob ich Sportler bin. Wenn ich dann meine bisherige Identität in Frage stelle und mir zuschreibe, jemand anderes zu sein, als ich bisher war, wird es mir leichter fallen, meine Gewohnheiten an diese neue Identität anzupassen. Schreibe ich Blog-Beiträge? Oder bin ich Schriftsteller? Spiele ich ein Instrument oder bin ich ein Musiker? Stärke ich meine Mitarbeiter:innen? Oder bin ich Führungskraft? Wurschtel ich vor mich hin? Oder bin ich Unternehmer?
Dem folgend schlägt Clear vor, im ersten Schritt zu entscheiden, welche Identität wir haben wollen, um diese dann durch unser tägliches Handeln, unsere Gewohnheiten zu bestätigen.
Organisatorisch ist der Transfer einfach. Wenn die bisherige Identität des Teams oder der Organisation wirklich in Frage gestellt werden darf, dann gelingt es, neue Wege zu eröffnen, wie in Zukunft zusammengearbeitet werden soll. Wenn ich aber an viele Beratungsaufträge denke, wollen die Organisationen nicht ihre Identität überdenken, sondern hier und da etwas anders arbeiten.
Konkret geht es zum Beispiel darum, neue Strategien für die kurz- und mittelfristige Zukunft zu entwickeln. Da fallen dann Begriffe wie „personenzentriert“, „anpassungsfähig“, „schnell“ oder „nachhaltig“. Alles schön und gut. Aber die Identität der Organisation bleibt im Kern unangetastet. Die Mitarbeiter:innen agieren weiterhin in ihren bewährten Gewohnheiten, da sie sich ja immer noch im gleichen Unternehmen wiederfinden und die Führung wundert sich, warum die Strategieumsetzung so zäh ist…
Dabei ist zu beachten, dass schon die individuelle Anpassung der eigenen Identität nicht einfach ist: Selbst wenn ich mir drei Tage lang einrede, ich sei ein Sportler, werde ich am vierten Tag von einer Erkältung niedergestreckt und muss viel Energie aufwenden, um trotz des Rückschlags an meiner Identität festzuhalten.
Dasselbe gilt in noch stärkerem Maße für Organisationen als soziale Systeme:
- Welche Geschichten werden wie nach innen und außen erzählt, um die Identität der Organisation neu zu schreiben?
- Wer erzählt diese Geschichten?
- Wo manifestiert sich die neue Identität?
Hier sind insbesondere die Führungskräfte gefordert, die neue Identität durch Geschichten, durch neue Narrative und das eigene Vorleben zu festigen. Und das wiederum erfordert eine echte Überzeugung, dass die neue Identität mehr ist als nur ein schöner Satz in einem Hochglanz-Leitbild.
Das gilt auch für die gesellschaftliche Ebene:
Solange die Politik im Klein-Klein und in den Grabenkämpfen der Parteien verharrt und keine neue „Identität des Landes“, keine Visionen und Utopien glaubwürdig vermitteln kann, wird sich wenig bewegen. „Die Frage „Wie wollen wir leben?r nicht leicht zu beantworten. Aber so wie aktuell wird die Politikverdrossenheit eher weiter zunehmen, was – bezogen auf die eigentlich dringend anzugehenden Ziele – höchst dramatisch ist.
Also noch mal kurz: Entscheide, wer Du sein willst und bestätige dies mit kontinuierlichen, kleinen Schritten.
Vergiss das Ziel, fokussiere dich auf das System!
Ich komme auf das ganze Thema, da ich gerade „Atomic Habits“ von James Clear lese.
Kurz gesagt geht es in diesem Buch um die Kunst, das eigene Leben durch die Änderung kleiner, alltäglicher Gewohnheiten zu verbessern.
Gewohnheiten – ob positiv oder negativ – entstehen durch die Abfolge von vier Schritten
- Auslöser
- Begehren
- Reaktion
- Belohnung.
Dementsprechend lassen sich Verhaltensänderungen durch kontinuierliche, aber inkrementelle Anpassungen in diesen vier Bereichen erreichen.
Es ist (natürlich) sinnvoller, sich auf die Entwicklung von Gewohnheiten zu konzentrieren, die uns helfen, unseren Zielen (dem System) näher zu kommen, als auf die Ziele selbst. konzentrieren:
„The purpose of setting goals is to win the game. The purpose of building systems is to continue playing the game“
(S. 27)
Das ist einfach erklärt:
Ich persönlich kann zwar das Ziel haben, mehr Sport zu treiben. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht zu meinem Ziel passen, dann wird aus dem Ziel sicher nichts. Wenn die Reifen am Fahrrad kaputt sind, die Joggingschuhe noch im Geschäft stehen und der Alltag vollgestopft ist mit Krimskrams, dann wird es mir trotz aller Disziplin nicht gelingen, dem Ziel auch nur einen Schritt näher zu kommen – auch wenn ich es mir noch so sehr vornehme. Erst wenn es mir gelingt, das System und damit die Rahmenbedingungen anzupassen, kann ich mich überhaupt auf den Weg zum Ziel machen.
Organisatorisch gilt ähnliches: Man kann Fehler-, Innovations- oder Lernkultur propagieren und hoffen, dass dadurch etwas passiert. Aktuell populär ist natürlich das Ziel „Agilität“ oder das Ziel einer agilen Organisation. Aber solange das System nicht bereit ist, den Weg der Agilität, des Lernens oder der Innovation zu gehen, wird mit ziemlicher Sicherheit nichts passieren. Wahrscheinlicher ist sogar, dass deine Mitarbeiter:innen deine Ideen belächeln, auf die letzte „Change-Reise“ oder den letzten, komplett sinnlosen Innovationsworkshop verweisen und genauso weitermachen wie bisher. Immer öfter höre ich von Kund:innen Sätze wie:
Und gesellschaftlich erleben wir leider an vielen Stellen das Gleiche:
Jeder weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Auch das Ziel ist klar: 1,5 Grad, sonst wird es richtig ungemütlich. Aber das System passt nicht: Der Kapitalismus in seiner jetzigen Form verhindert das Einschwenken auf einen nachhaltigen Lebensweg.
Kurz gesagt: Wir kommen auf allen Ebenen unseren Zielen nicht näher, sondern fallen immer wieder auf das Niveau unserer Systeme zurück. (vgl. hier).
Gewohnheiten ändern in vier Schritten!
Aber wie kann man Gewohnheiten ändern – individuell, organisatorisch und vielleicht sogar gesellschaftlich?
Clear beschreibt – basierend auf den oben genannten vier Schritten – vier „Gesetze“, die helfen, gute Gewohnheiten aufzubauen:
Das 1. Gesetz (Auslöser): Mache es offensichtlich.
Das 2. Gesetz (Verlangen): Mach es attraktiv.
Das 3. Gesetz (Reaktion): Mache es einfach.
Das 4. Gesetz (Belohnung): Mache es befriedigend.
Schlechte Gewohnheiten werden durch die Umkehrung der vier Gesetze abgebaut:
Umkehrung des 1. Gesetzes (Auslöser): Mache es unsichtbar.
Umkehrung des 2. Gesetzes (Verlangen): Mach es unattraktiv.
Umkehrung des 3. Gesetzes (Reaktion): Mache es schwierig.
Umkehrung des 4. Gesetzes (Belohnung): Mache es unbefriedigend.
So weit, so individuell. Und eigentlich auch für mich in vielen Lebensbereichen spannend. Nehmen wir das (fast rein fiktive 😉 Beispiel, dass ich selbst Autor werden möchte und mir das Schreiben zur Gewohnheit machen möchte. Wie muss ich dann mein individuelles System gestalten?
- Ich muss den Auslöser zum Schreiben sichtbar machen. Ich kann mir zum Beispiel jeden Morgen eine Stunde im Kalender eintragen, die nur für das Schreiben reserviert ist. Außerdem kann ich meinen Schreibtisch von Ablenkungen befreien, damit ich mich direkt auf das Schreiben konzentrieren kann.
- Schreiben muss attraktiv werden: Wo schreibe ich am liebsten? Ist mein Schreibtisch im Keller immer noch die beste Alternative? Oder sollte ich nicht lieber ein Zugticket buchen, vier Stunden hin, vier Stunden zurück, und im Zug arbeiten? Da gibt es wenigstens wenig Ablenkung…
- Ich muss den Zugang zu guten Schreibbedingungen sehr einfach gestalten. Daraus ergeben sich zum Beispiel folgende Fragen: Wo steht mein Computer? Fühle ich mich dort wohl? Wie aufwändig ist es, in den Schreibprozess einzutauchen?
- Wie belohne ich mich selbst? Beim Bloggen ist es ganz cool, positive Reaktionen auf Beiträge zu bekommen. Aber reicht das? Könnte ich Schreibphasen nicht expliziter mit – gesunden – Belohnungen abschließen?
Ich denke viel darüber nach, wie ich es schaffe, Unternehmer zu werden und welche Gewohnheiten ich mir dafür aneignen muss… Wenn du Tipps und Ideen hast, würde ich mich freuen, wenn du sie in den Kommentaren hinterlässt!
Das Gesagte lässt sich auch auf Organisationen übertragen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Dein Team die Entscheidung getroffen hat, „agil“ zu sein. Diese Entscheidung betrifft die Identität des Teams und sollte sehr bewusst gemeinsam getroffen werden.
Dann stellt sich die Frage: Wie kannst Du im Team die vier „Gesetze“ anwenden, um kleine Schritte in Richtung dieser „agilen Identität“ zu gehen und so zu dem Team zu werden, das Ihr sein wollt?
Bevor ihr daran arbeitet, neue Routinen und Gewohnheiten zu implementieren, ist es sinnvoll, zunächst zu schauen, welche Routinen in Bezug auf die Identität dysfunktional sind. Dysfunktional im Sinne der „neuen Identität“ wären alle Praktiken, Gewohnheiten oder unentschiedenen Entscheidungsprämissen, die starre, unflexible, langwierige Arbeitsprozesse bedienen. Was davon kann weg? Es geht also zunächst um die Umkehrung der vier Gesetze:
- Umkehrung des ersten Gesetzes (Auslöser): Wie können wir die Auslöser von dysfunktionalen Gewohnheiten möglichst unsichtbar machen? Ein Beispiel: Bisher habt ihr Teamsitzungen so gestaltet, dass du als Führungskraft die Tagesordnung vorgegeben hast und die Teamsitzung anhand der vorgegebenen TOPs moderiert hast. Mach es beim nächsten Mal anders: Bestimmt gemeinsam eine:n Moderator:in und legt zu Beginn gemeinsam die Tagesordnung fest.
- Umkehrung des 2. Gesetzes (Verlangen): Wie können wir die Gewohnheit möglichst unattraktiv machen? Wenn ihr – um im Beispiel zu bleiben – bisher Entscheidungen zu einzelnen TOPs nicht gemeinsam getroffen habt, sondern immer nach der Führungskraft geschaut und auf deren Entscheidung gewartet habt, wäre es denkbar, dass vorher klar vereinbart wird, Entscheidungen, die alle im Team betreffen, nur noch gemeinsam zu treffen (z.B. mit Hilfe der Konsensmethode).
- Umkehrung des 3. Gesetzes (Reaktion): Auch wenn Absprachen getroffen wurden, kann es sein, dass die Routine trotzdem zuschlägt und auf die Entscheidung des Vorgesetzten wartet. Wie wäre es, wenn der Vorgesetzte einfach nicht mehr an den Teamsitzungen teilnimmt und Entscheidungen im Team getroffen werden müssen?
- Umkehrung des 4. Gesetzes (Belohnung): Wie können wir den Rückfall in alte Gewohnheiten möglichst unbefriedigend gestalten? Denkbar wäre z.B. die Einführung einer „Teamstrafe“ für jede Entscheidung, die nicht mit Hilfe der Konsensmoderation gemeinsam getroffen wird (wobei mir noch nicht ganz klar ist, was das genau sein könnte)…
Allein durch die Bekämpfung und Beseitigung von dysfunktionalen Gewohnheiten kann Raum zum Atmen, für neues Denken und Handeln geschaffen werden. Welche hilfreichen Gewohnheiten könnten anders, besser, funktionaler für das Team und die Organisation sein? Darauf aufbauend können die vier Gesetze zur Entwicklung funktionaler Gewohnheiten angewendet werden:
Die Anwendung des 1. Gesetzes (Auslöser) bedeutet, den Auslöser für eine neue funktionale Gewohnheit so offensichtlich wie möglich zu machen. Wie kannst Du es möglichst offensichtlich machen, dass eine neue Handlung ausgeführt werden soll? Eine Möglichkeit wäre z.B. ein einfaches Kanban-Board im Büro (oder digital) aufzuhängen, auf dem die Aufgaben im Team visualisiert werden?
Das 2. Gesetz (Begehren) stellt die Frage nach der Attraktivität. Gewohnheiten ändern sich, wenn wir das, was wir tun wollen, mit dem verbinden, was wir ohnehin tun müssen. Im Beispiel wäre es denkbar, dass das Kanban-Board direkt zur Planung, Strukturierung und Dokumentation der Teamsitzung genutzt wird.
Und dann muss es – 3. Gesetz (Reaktion) – möglichst einfach zu bedienen sein. In meinem vorherigen Job hatte ich die grandiose Idee, Mastertask im Team zur Sortierung der Aufgaben einzusetzen. Aber das war den Teammitgliedern zu kompliziert. Wir sind wieder beim bewährten Word-Dokument gelandet – warum nicht, wenn es funktioniert und zum Ziel führt?
Beim 4. Gesetz (Belohnung) geht es ein wenig in Richtung Pawlowscher Hund: Wie können im Team Belohnungen geschaffen werden, die das wiederholte Ausführen der neuen Gewohnheit verstärken? Individuell wäre das vielleicht der Kaffee nach der erledigten Aufgabe oder – bei der Schreibgewohnheit – die kurze Pause nach 2000 Zeichen. Im Team könnte es z.B. das „habit tracking“ sein, die Visualisierung der Tage, an denen das Kanban-Board erfolgreich genutzt wurde.
Neue Wege im organisationalen Dschungel
Die Veränderung von Gewohnheiten kann mit der Suche nach neuen Wegen im Dschungel verglichen werden, sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer und gesellschaftlicher Ebene.
So gibt es im Dschungel bereits breit ausgetretene Gewohnheitspfade, vielleicht gepflastert und mit Straßenlaternen beleuchtet. Von diesen abzuweichen erfordert bewusstes Gegensteuern.
Dies gelingt aber nicht allein durch das Propagieren der Nützlichkeit neuer Wege oder durch das Verlassen alter Pfade. Vielmehr braucht es
- die Bewusstwerdung der neuen Identität: Wer will ich sein? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben?
- die Veränderung des Systems, damit es selbstverständlich, einfach, attraktiv und lohnend wird, die neuen Wege zu gehen.
- die Veränderung der bisherigen Gewohnheiten.
Wenn es allein gelingt, dysfunktionale Gewohnheiten loszulassen, sind wir individuell, organisational und gesellschaftlich einen großen Schritt weiter.
Und wenn es dann noch gelingt, viele neue, funktionale Wege auf dem Weg gut vorzubereiten und konsequent zu gehen, kann es gelingen, die eigene Organisation oder das eigene Team in Richtung „neue Identität“ zu verändern und eine neue Team- oder Organisationskultur nicht nur irgendwo hinzuschreiben, sondern tatsächlich zu leben.
Wo und wie ist es Dir gelungen, Gewohnheiten – individuell, in Deinem Team der Organisation zu ändern? Teile doch Deine Erfahrungen in den Kommentaren! Danke!!!


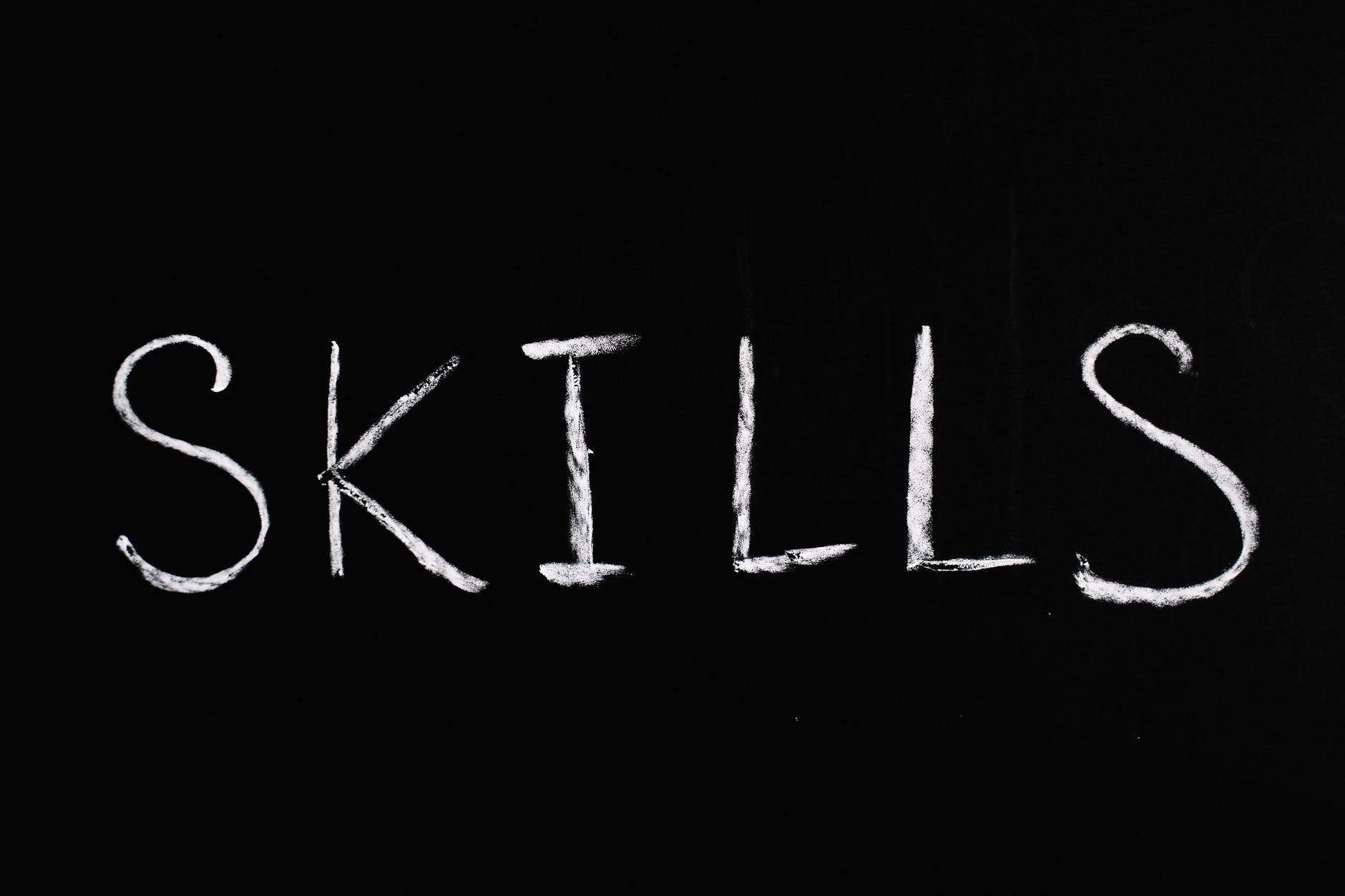



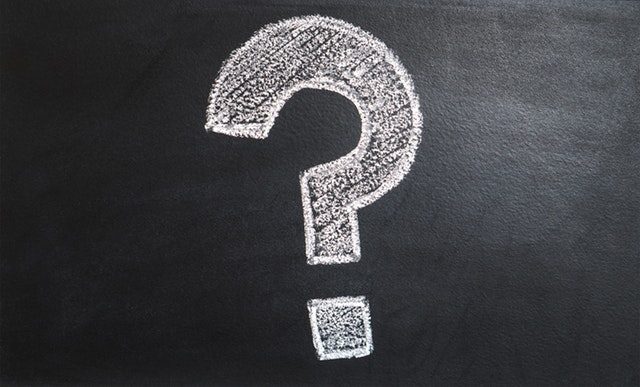



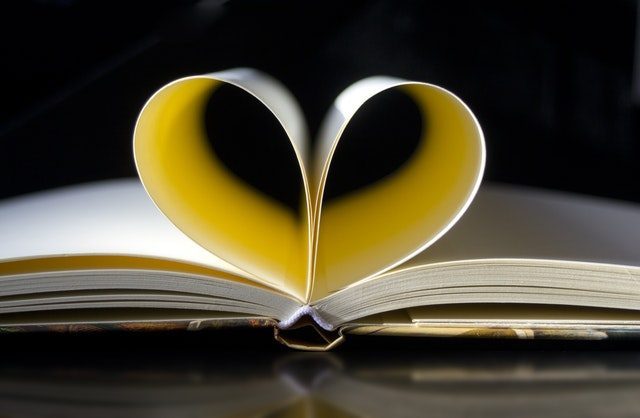

Neueste Kommentare