Beendigung der Armut. Beseitigung der eklatanten Ungleichheit. Ermächtigung der Frauen. Dies sind die drei der fünf „außerordentlichen Kehrtwenden“, die laut dem neuen Bericht an den Club of Rome „Earth for All“ (vgl. Dixsons-Declève et al., 2022) notwendig sind, um die Risiken der Klimakatastrophe substanziell zu reduzieren. Angeführt werden darüber hinaus der Aufbau eines für Menschen und Ökosysteme gesunden Nahrungsmittelsystems und der Einsatz sauberer Energie, um die Menschheit zu retten.
Der Anspruch Sozialer Arbeit
Beendigung der Armut, Beseitigung der eklatanten Ungleichheit, Ermächtigung der Frauen – dies könnte gut eine anspruchsvolle Mission einer sozialen Organisation oder eines Wohlfahrtsverbands sein: Welt retten, um die Menschheit zu retten – reduziert auf das Machbare.
Das lässt den Anspruch Sozialer Arbeit erkennen: Soziale Arbeit will die Lebenswelt der Menschen, für die soziale Organisationen die (Mit-)Verantwortung tragen, besser machen, was auch beim Blick auf die Internationale Definition Sozialer Arbeit (vgl. DBSH, 2016) deutlich wird:
Soziale Arbeit fördert „gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. (…). Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern“.
Soziale Arbeit hat sich viel vorgenommen! Es stellt sich die Frage, ob wir – jede*r Einzelne, unsere Organisationen und die Soziale Arbeit als Ganzes – diesem Anspruch in der Vergangenheit gerecht wurden und in der Zukunft gerecht werden können.
Vergangenheit und Zukunft, oder: Das Ende des Business as Usual
Der Blick in die Vergangenheit bis zur Gegenwart der Sozialen Arbeit zeigt Licht und Schatten. Die Entwicklung Sozialer Arbeit lässt sich als „wahre Erfolgsgeschichte“ (Merten, 2001, 165) erzählen. Hans Thiersch spricht vom letzten Jahrhundert gar als „sozialpädagogisches Jahrhundert“ (vgl. 1992). Das Wachstum des Sozialwesens, gemessen an Beschäftigtenzahlen oder volkswirtschaftlichem Nutzen, ist beeindruckend.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das quantitative Wachstum des Sozialwesens mit qualitativen Verbesserungen, mit der Steigerung der Wirksamkeit Sozialer Arbeit und der Annäherung an die in der Definition Sozialer Arbeit dargelegten Vision einherging. Ohne Frage hat sich „die Soziale Arbeit“ weiterentwickelt. Aber fördert sie wirklich gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen, den sozialen Zusammenhalt und die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen? Da können Zweifel aufkommen.
Und der IW-Kurzbericht „Die Berufe mit den aktuell größten Fachkräftelücken“ (Hickmann, Koneberg, 2022) zeigt, dass Berufe in den Bereichen Sozialarbeit / Erziehung / Pflege schon heute besonders vom Fachkräftemangel betroffen sind. Das spüren die Beschäftigten an allen Ecken. Soziale Organisationen bewegen sich in den uns alle betreffenden Polykrisen (vgl. bspw. Scharmer, 2022) am Rande der Belastungsgrenze.
Für die Gestaltung der Zukunft ist da wenig Platz, denn wenn man linear in die Zukunft sozialer Organisationen blickt, ergibt sich folgendes Bild:
Angesichts demographischer Entwicklungen steigt der Gesamtbedarf an personenbezogenen Dienstleistungen bei gleichzeitig abnehmender Anzahl an Erwerbstätigen. Herausforderungen wie Digitalisierung, Energiekrise, Krieg, Klimakatastrophe kommen hinzu.
Wenn es weitergeht, wie bisher, können die Belastungsdämme der Organisationen und der Sozialwirtschaft nicht mehr lange standhalten.
Die triviale Folgerung aus diesem kurzen Überblick muss lauten (und nach Innen und Außen lauter werden):
Ein „Weiter so!“, ein „Business as usual“ kann und wird nicht mehr funktionieren. Es braucht „Transformation hin zum Neuem“!
Aber wie sieht das Neue aus? Und vor allem: Wie kann die Transformation dorthin gelingen?
Um diese Fragen spezifisch für soziale Organisationen zu beantworten, lohnt es sich, ausgehend von den Kehrtwenden des Club of Rome, den Blick zu weiten: Wie kann Transformation auf globaler Ebene gelingen und was lässt sich daraus für soziale Organisationen lernen und adaptieren?
Gemeinsam Spüren, oder: Echte Transformation braucht neues Lernen
Im Folgenden wird eine von drei notwendigen Veränderungen herausgegriffen, die angesichts der aktuellen Krisen erforderlich sind, um die Forderungen des Club of Rome auf der systemischen Makroebene, also auf globaler, nationaler und/oder der Ebene der Funktionssysteme (Bildung, Politik, Gesundheit, Soziales…) umzusetzen:
Es braucht die Transformation des Lernens – weg von der Leistungs- und Prüfungsorientierung hin zur Entwicklung von Fähigkeiten zum gemeinsamen Spüren und zur gemeinsamen, ko-kreativen Gestaltung der Zukunft (vgl. Scharmer, 2022).
Der Gedanke, dass wir zur Bewältigung der globalen Krisen die Art, wie wir Lernen verstehen, ändern müssen, ist nicht neu: Bereits der im Jahr 1979 im Anschluss an den 1972 veröffentlichten Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte Bericht des Club of Rome unter dem Titel „No limits to learning“ rückt explizit das Thema „innovative learning“ in den Vordergrund. Darunter ist ein Lernen zu verstehen, das Kreativität und effektive Kooperation ins Zentrum rückt (vgl. Göpel, 2022, 132). Über Neu-Lernen, die Entwicklung kreativer Fähigkeiten und Kooperation kann es gelingen, die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu schließen.
So wissen wir, was wir tun sollten, kommen aber oft nicht ins Handeln. Rechtliche, institutionelle und individuelle Abhängigkeiten hindern uns daran, gemeinsam neu zu Lernen und das Business as usual nicht nur ernsthaft infrage zu stellen, sondern wirklich anders zu agieren.
Aber wie können wir neu Lernen lernen und das kollektive Gefühl von „so kann es nicht mehr weitergehen“ transformieren in das Neue?
Dazu braucht es (vgl. Scharmer, 2022):
- institutionelle Infrastrukturen, die alle relevanten Akteure zusammenbringen, um das System gemeinsam zu gestalten,
- Führungsinstrumente und -kapazitäten, um das Bewusstsein der verschiedenen Akteure von einer Silo- zur Systemsicht zu verändern und
- finanzielle Mechanismen zur Finanzierung und Skalierung der oben genannten Maßnahmen.
Resonanz erzeugen, oder: Co-kreative institutionelle Infrastrukturen
Wir sind gefordert, in unseren Organisationen co-kreative institutionelle Infrastrukturen und damit Dialogräume zu gestalten, in denen es gelingt, Resonanz (vgl. Rosa, 2022) zwischen den Themen und den verschiedenen Akteur*innen zu erzeugen.
Resonanz meint a) die Fähigkeit, „sich anrufen zu lassen“ (ebd., 57). Damit ist das Hören und Spüren des dezidiert Anderen, des Neuen gemeint – „und das kann durchaus irritierend sein“ (ebd., 59). Hier ist die Verbindung zur organisationalen Innovations- und damit Lernfähigkeit interessant: Für die Ermöglichung von Innovation ist es notwendig, „irritationsrelevante Informationen“ wahrzunehmen bzw. sich von diesen „anrufen“ lassen zu können.
Aus dem „angerufen werden“ folgt b) die Selbstwirksamkeit: „Ich stelle plötzlich fest, (…), dass ich in der Lage bin auf das Empfangene zu reagieren“ (ebd., 60). In Bezug zur organisationalen Innovationsfähigkeit gilt es, die irritierenden Informationen aus der Umwelt für die Organisation nutzbar machen zu können.
Aus der Fähigkeit, „sich anrufen zu lassen“ und selbst wirksam zu werden entsteht dann c) die Möglichkeit echter Verwandlung bzw. Transformation:
„Da, wo Resonanz zustande kommt, wo ich wirklich aufhöre, und mich mit dem, was mich erreicht, verbinde, verwandle ich mich“ (Rosa, 2022, 62).
Und genau darum geht es: Um Verwandlung, um Transformation, die als Abkehr vom Business as Usual das Neue, echte Innovation und tiefgreifende Veränderung ermöglicht.
Der Moment der Resonanz kann jedoch nicht gekauft, hergestellt oder erzwungen werden. Resonanz ist d) unverfügbar (vgl. ebd., 64). Und genauso ist es in Organisationen:
Appelle an die Mitarbeiter_innen, „jetzt aber mal innovativ zu sein“ oder das Erzwingen nicht resonanzfähiger „New Work Maßnahmen“ werden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ergebnislos verpuffen, wenn nicht echte, strukturelle Veränderungen erfolgen, die anderes Arbeiten nach sich ziehen.
Auf-Hören, oder: Systemische Führungsinstrumente und -kapazitäten
Im obigen Zitat irritiert das Wort „aufhören“. Rosa verbindet mit dem Auf-Hören das sich „anrufen und erreichen lasse[n] von etwas anderem, von einer anderen Stimme, die etwas anderes sagt als das, was auf meiner To-Do-Liste steht und was sowieso erwartbar ist“ mit dem gängigen Verständnis des Begriffs Aufhören im Sinne von „anhalten, stoppen“ (ebd., 56).
Beides ist wichtig: Zum einen gilt es, aufzuhorchen und sich von den irritierenden Informationen aus der Umwelt anrufen zu lassen, um daraus Neues zu gestalten. Zum anderen gilt es aber auch, aufzuhören und Aktivitäten zu stoppen, die keinen Mehrwert für die Menschen und die Organisation liefern.
Es lohnt die Beschäftigung mit Exnovation – der anderen Seite von Innovation: Exnovation heißt, dass Nutzungssysteme, Prozesse, Praktiken oder Angebote, die getestet und bestätigt wurden, aber nicht mehr wirksam sind oder nicht mehr mit der Strategie übereinstimmen, eingestellt werden (vgl. Epe, 2022). Exnovation heißt jedoch keinesfalls, in der Organisation eine Kultur der Nicht-Innovation zu propagieren. Exnovation, das Aufhören, die Abschaffung, das Beenden, gehört zur Innovation zwingend dazu – wie zwei Seiten einer Medaille.
Und hier sei mit Blick auf das „sozialpädagogische Jahrhundert“ die Frage gestattet: Wo haben wir im Sozialwesen erfolgreich Dinge nicht mehr getan, nicht (mehr) wirksame Angebote nicht weitergeführt und wirklich aufgehört, um so Raum für Neues zu schaffen?
Gleiches gilt institutionell: Anstatt grundlegende, strukturelle Barrieren zu beseitigen, die die Veränderung des Systems blockieren, versuchen wir, Menschen zu motivieren, „sich zu verändern“ und neue Methoden und Angebote zu schaffen, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Echtes Lernen und damit Veränderung komplexer sozialer Systeme geschieht aber nicht, indem wir „mehr des Gleichen“ tun. Die Beseitigung struktureller Barrieren, das Weglassen, das Exnovieren ist oft der wirkungsvollste Hebel, um soziale Systeme und damit Organisationen in Veränderung zu bringen.
Veränderung bedeutet, etwas aus dem gewohnten Trott zu bringen. Es mag zwar oberflächlich beruhigend und entlastend sein, sich an Routinen und Business as usual zu klammern. Sinnvoller ist aber die Frage: Was von dem, was wir in unserer Organisation oder im Team tun, kann weg, womit können wir aufhören?
Bezogen auf Vorgaben in Organisationen hat sich zur Beantwortung der Frage die einfache Methode „Kill a stupid rule“ bewährt:
- In Kleingruppen sammeln die Beteiligten regelmäßig bestehende Regeln aus ihrer Organisation, die sie gerne abschaffen/ändern würden und notieren diese.
- Die Notizen werden vorgestellt und in ein Koordinatensystem eingruppiert: wenig bis sehr aufwändig und kleine bis große Wirkung.
- Ideen mit wenig Aufwand und großer Wirkung können direkt angegangen werden. Ideen mit mehr Aufwand kann man priorisieren und nach und nach umsetzen.
Eigentlich einfach, aber wir wissen auch: Das Auf-Hören fällt schwer – gesellschaftlich, organisational und individuell.
Kooperation, oder: Finanzielle Mechanismen zur Finanzierung und Skalierung der Maßnahmen
So, wie in unseren Organisationen nicht eine Person allein „den Laden am Laufen hält“ lässt sich die Transformation der Gesellschaft nicht durch „den einen Hebel“ und damit losgelöst von anderen sozialen Systemen betrachten. Mehr noch:
„Kooperation war die entscheidende Voraussetzung für die Entstehung des Lebens, und sie ist bis heute ein das Leben in all seinen Varianten begleitendes Phänomen geblieben“ (Bauer, 2006, 221).
Wollen wir die Zukunft des Sozialwesens gestalten und die Abkehr vom Ego- zum Eco-System und Möglichkeiten gestalten, „vom größeren Gesamtsystem aus zu handeln“ (Scharmer, 2013, 220), müssen wir eine Kultur der Kooperation (wieder)beleben, auch wenn dies „ein radikaler Gegenentwurf zum neoliberalen und zum auf Verdrängungswettbewerb und Auslese aufbauenden darwinistischen Menschenbild [ist], das Ökonomie und Gesellschaft seit langer Zeit und heute noch prägt“ (Seliger, 2022, 119).
Kooperation erfolgt in vielen Fällen bereits zwischen sozialen Organisationen und zwischen unterschiedlichen Verbänden (auch wenn es hier ebenfalls Entwicklungsbedarf gibt). Aber gerade mit Blick auf die Finanzierung Sozialer Arbeit ist der Blick auf Kooperation hochgradig relevant:
Soziale Organisationen sind in ihrer Finanzierung im Wesentlichen abhängig von Sozialleistungsträgern. Entsprechend greift der isolierte Blick auf die institutionelle Transformation, auf innerorganisationale Veränderungsnotwendigkeit zu kurz – ohne damit zu sagen, dass innerhalb der Organisationen keine Veränderungen stattfinden sollten – da sie in der Finanzierung ihrer Leistungen abhängig sind von den Sozialleistungsträgern.
Eine Herausforderung der Verbindung von Sozialleistungsträgern auf der einen und sozialen Organisationen als Leistungserbringern auf der anderen Seite besteht aber darin, dass beide Systeme unterschiedliche binäre „Leitdifferenzen“ (Codes) aufweisen, anhand derer sich die Entscheidungen im jeweiligen System orientieren.
Soziale Organisationen wägen ihre Entscheidungen – sehr grob formuliert – anhand der Leitdifferenz „Helfen / nicht helfen“ (vgl. Kleve, 2007, 147) ab, wohingegen die Sozialleistungsträger ihre Entscheidungen anhand der Leitdifferenz „Rechtlich vorgegeben / nicht vorgegeben“ abwägen.
Daraus folgt, dass soziale Organisationen komplexe soziale Probleme anders angehen würden, wenn die Finanzierungsmöglichkeiten dies zuließen. So wird bspw. die Einbeziehung der Klient*innen und die Stärkung ihrer Autonomie und Selbstbestimmung in allen moderneren Methoden Sozialer Arbeit gefordert, deren Umsetzung jedoch in Teilen durch die Notwendigkeit konterkariert, sich an die Vorgaben der Sozialgesetze zu halten, um darüber die Finanzierung sicherzustellen.
Zur zukünftigen Sicherstellung einer sinnvollen Finanzierung ist es also notwendig, die Kooperation zwischen den Leistungsträgern und den Leistungserbringern deutlich zu steigern, um über den Dialog ein gegenseitiges Verständnis der Notwendigkeiten wirksamer Finanzierung herzustellen.
Außerdem ist in sozialen Systemen, großen wie kleinen, alles miteinander verbunden (vgl. Göpel, 2022, 36ff). Entsprechend muss der kooperationsfokussierte Blick über die Grenzen der Sozialwirtschaft hinaus geweitet werden: Kooperation muss auch verstärkt zwischen anderen Unternehmen und Funktionssystemen gestärkt werden, um Transformation zu ermöglichen.
Das Ausweiten der Kooperation vereinfacht wiederum das unverzichtbare „Sich-anrufen-lassen“ von anderen Perspektiven und neuen Möglichkeiten, die ergriffen werden können, um gelingende Zukunft zu gestalten.
Das Ende des Business as usual, oder: Mutige Visionen für die Zukunft der Sozialwirtschaft
Es muss nicht wiederholt werden, dass die Herausforderungen, denen sich soziale Organisationen heute und in Zukunft widmen müssen, massiv sind. Sie werden heute nicht absehbare Veränderungen erfordern. Einfache Antworten und Business as usual werden aber definitiv nicht funktionieren, auch wenn die Suche nach Sicherheit und Beständigkeit in einer hyperaktiven Welt allgegenwärtig ist. Aber es hilft nicht, angesichts der Dynamik und Komplexität der Herausforderungen den Kopf in den Sand zu stecken. Das Gute in der aktuellen Situation: In allen Problemen (ver-)stecken sich auch Chancen, wenn wir lernen, mutige Visionen der Zukunft der Sozialwirtschaft in den Blick zu nehmen:
Mutige Visionen brechen mit dem Business as Usual. Sie helfen uns, die Gegenwart hinter uns zu lassen und damit neue Perspektiven einzunehmen.
Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen auf und gehen an Ihren Arbeitsplatz. Dort muss über Nacht ein Wunder geschehen sein und es ist alles so, wie Sie es sich schon immer erträumt haben:
- Woran bemerken Sie, dass sich etwas verändert hat?
- Was sind die größten Unterschiede zu gestern?
- Wie fühlt sich die Veränderung an? Was ist beglückend?
- Mit welchem Bild würden Sie die neue Situation Ihrer Organisation darstellen?
Beginnen Sie, Ihre Vision mutig zu malen, denn
„Mut heißt nicht, keine Angst zu haben! Mut heißt nur, dass man trotzdem springt!“ (Sarah Lesch).
Quellen:
- Botkin, J. W., Elmandjra, M., Malitza, M.: No limits to learning: bridging the human gap. 1st ed. Pergamon international library. Oxford; New York: Pergamon Press, 1979.
- DBSH. Deutschsprachige Definition Sozialer Arbeit. 2016. Download unter: https://www.dbsh.de/profession/definition-der-sozialen-arbeit/deutsche-fassung.html. Abruf am 16.12.2022.
- Dixson-Declève, S., Gaffney, O., Ghosh, J., Randers, J., Rockström, J., Espen Stoknes, P.: Earth for all: ein Survivalguide für unseren Planeten. Übersetzt von Rita Seuß und Barbara Steckhan. 4. Auflage. München: oekom, 2022.
- Epe, H.: Exnovation, oder: Verlernen allein reicht (oft) nicht! Download unter: https://www.ideequadrat.org/exnovation/. Download am 03.01.2023.
- Göpel, M.: Wir können auch anders: Aufbruch in die Welt von morgen. Berlin: Ullstein, 2022.
- Hickmann, H., Koneberg, F.: Die Berufe mit den aktuell größten Fachkräftelücken. IW-Kurzbericht Nr. 67. Download unter https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2022/IW-Kurzbericht_2022-Top-Fachkr%C3%A4ftel%C3%BCcken.pdf. Download am 20.12.2022.
- Kleve, H.: Postmoderne Sozialarbeit: ein systemtheoretisch-konstruktivistischer Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss, 2007.
- Merten, R.: Wissenschaftliches und professionelles Wissen – Voraussetzungen für die Herstellung von Handlungskompetenz. In: Pfaffenberger, Hans (Hrsg.). Identität – Eigenständigkeit – Handlungskompetenz der Sozialarbeit/Sozialpädagogik als Beruf und Wissenschaft. Münster, Hamburg, London: LIT Verlag, S. 165–192, 2001.
- Rosa, H.: Demokratie braucht Religion. München: Kösel-Verlag, 2022.
- Scharmer, O.: Protect the Flame. Circles of Radical Presence in Times of Collapse. 2022. Download unter: https://medium.com/presencing-institute-blog/protect-the-flame-49f1ac2480ac. Abruf am 15.12.2022.
- Scharmer, O.: Theorie U – von der Zukunft her führen: Presencing als soziale Technik. 3. Aufl. Management. Heidelberg: Carl-Auer-Verl, 2013.
- Seliger, R.: Systemische Beratung der Gesellschaft: Strategien für die Transformation. Erste Auflage. Systemische Horizonte. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH, 2022.
- Thiersch, H.: Das sozialpädagogische Jahrhundert. In: Rauschenbach, Thomas/Gängler, H. (Hrsg.). Soziale Arbeit und Erziehung in der Risikogesellschaft. Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand Verlag, S. 9–23, 1992.
Hinweis: Der Text ist vorab (in leicht angepasster Version) in den „Blättern der Wohlfahrtspflege“, 3/23, veröffentlicht worden. doi.org/10.5771/0340-8574-2023-3-96!


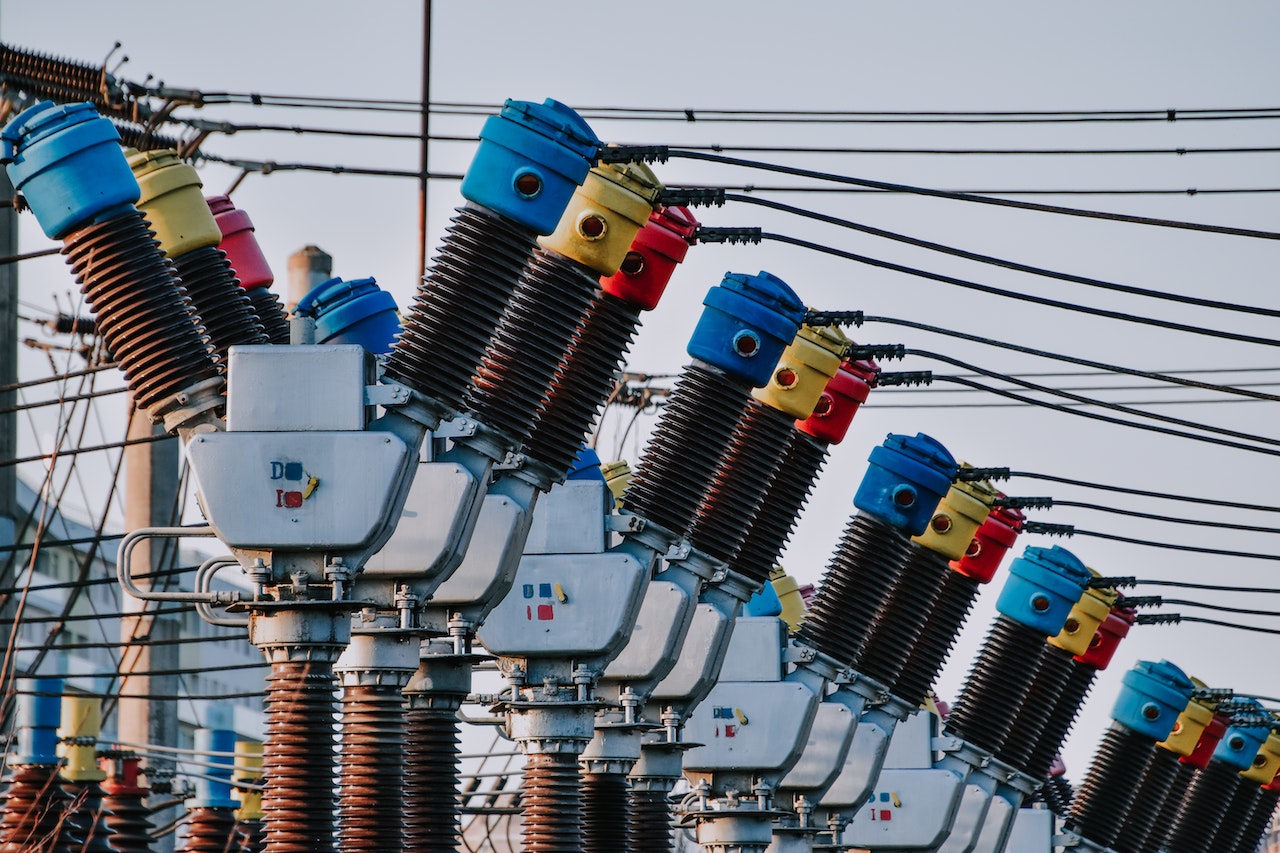

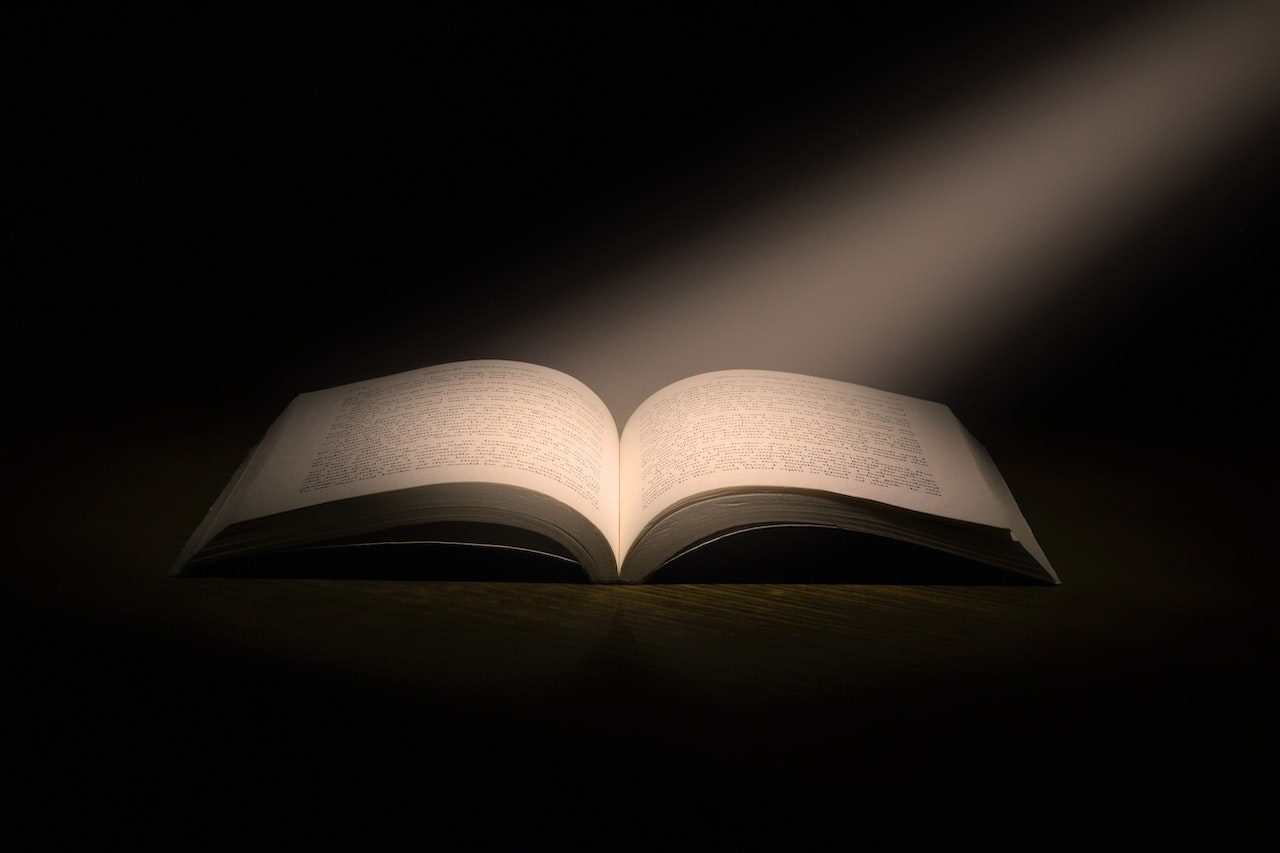


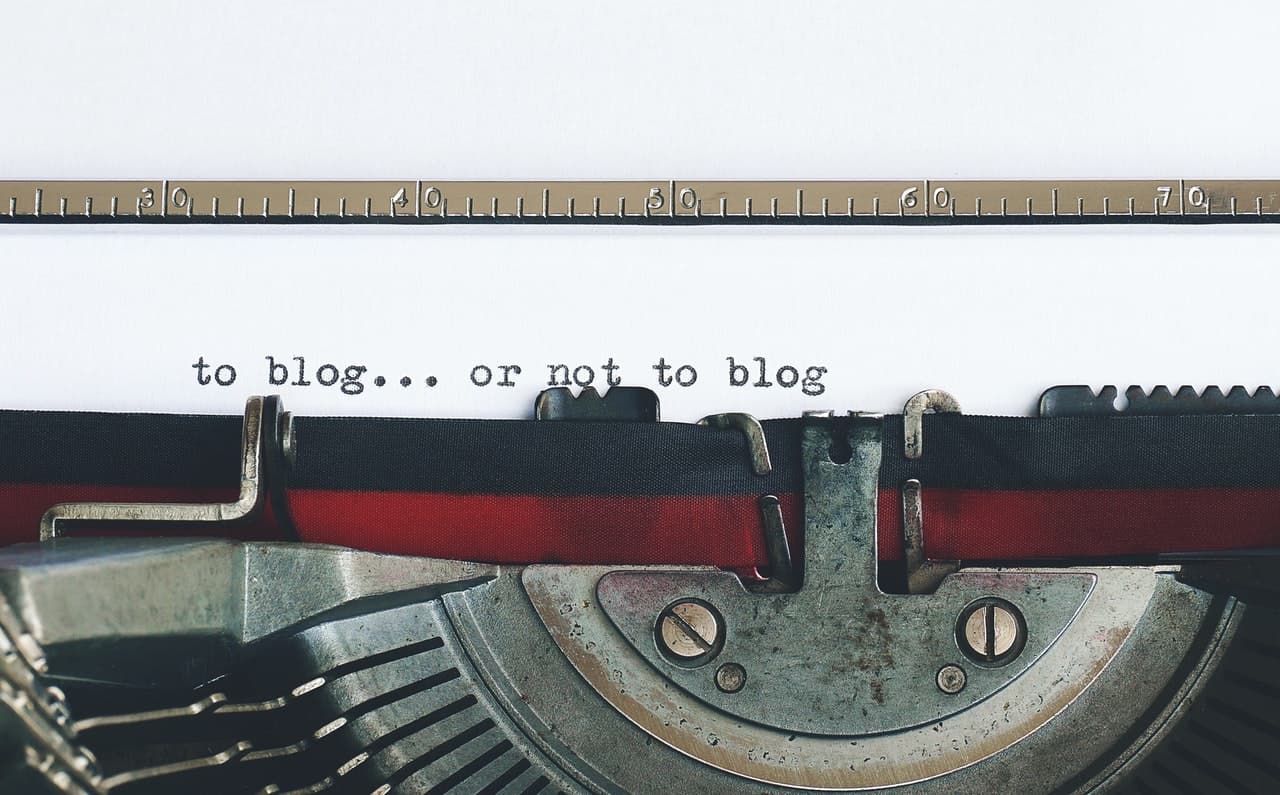




Neueste Kommentare