Die Arbeitswelt wandelt sich. Begriffe wie „agiles Arbeiten“, „Selbstorganisation“ und „New Work“ prägen den Alltag – auch in Organisationen der Sozialen Arbeit. Doch was ist darunter zu verstehen und vor allem: Was hilft, damit Organisationen der Sozialen Arbeit gelingende Teamarbeit trotz Fachkräftemangel ermöglichen können?
Zu dieser Frage haben Marion Kleinsorge und ich den folgenden Beitrag verfasst und hoffen, damit praxisnahe Antworten zu liefern, um den herausfordernden Alltag in Deiner Einrichtung bzw. Deinem Team positiv zu beeinflussen.
New Work – was steckt dahinter?
Wenn von „New Work“ die Rede ist, denken viele an Digitalisierung, Homeoffice oder ortsunabhängiges Arbeiten. Im Kontext der Sozialen Arbeit spielt das kaum eine Rolle: Oft verfügen Mitarbeitende nicht einmal über eine eigene dienstliche E-Mail-Adresse. Ihre Arbeit findet fast ausschließlich in der direkten Interaktion mit Klient:innen, Kolleg:innen, Angehörigen… statt.
Relevanter sind hier „New Work Dimensionen“ wie sinnstiftende Arbeit, Selbstorganisation, -bestimmung und -wirksamkeit, der Bedarf nach flexiblen Arbeitszeiten und die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Damit sind wir mitten im Alltag von Organisationen der Sozialen Arbeit angekommen.
Problematisch wird es aber dann, wenn „New Work“ missverstanden wird: Wenn Organisationen New Work als reiner Fokus auf die Mitarbeitenden verstehen und beginnen, sich primär um ihre – hoch individuellen – Wünsche zu drehen, gerät der eigentliche Zweck – die Arbeit mit und für benachteiligte Menschen – aus dem Blick. Das gefährdet langfristig das Überleben der jeweiligen Einrichtung.
INFOBOX New Work:
Der Name Frithjof Bergmann ist historisch eng mit dem Konzept der „Neuen Arbeit“ verbunden. Mit “New Work” lieferte Bergmann in den 1980er Jahren einen Gegenentwurf zum Kapitalismus, verstanden als Abkehr von der klassischen Lohnarbeit (hier mehr dazu). Von seinen bis heute visionären Ideen ist vor allem der Satz geblieben, dass Menschen das tun sollten, was sie „wirklich, wirklich tun wollen“. Dieser Satz hat viel zu dem heute populären Bild von New Work beigetragen, das sich mit der Gestaltung von “selbstorganisierten und sinnstiftenden Organisationen, in denen es den Mitarbeitenden gut geht“, zusammenfassen lässt. Unter diesem Bild findet sich dann eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten – vom Kickertisch über zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten bis hin zu „agilen Organisationen“. Klassische Merkmale von Organisationen haben es dagegen heute schwer: Hierarchien, klare Prozesse und einzuhaltende Regeln gelten als nicht mehr zeitgemäß – auch wenn sie nach wie vor ihre Berechtigung haben.
Statt also beliebig „irgendwas mit New Work“ zu implementieren oder gar „New Work Washing“ zu betreiben, gilt es, (nicht nur) in Zeiten des Fachkräftemangels die formale Team- und Organisationsstruktur zu gestalten.
Im Folgenden wird zunächst der Blick auf den Zweck von Organisationen der Sozialen Arbeit gerichtet, um darauf aufbauend konkrete Gestaltungsmöglichkeiten der formalen Organisationsstruktur aufzuzeigen – mit dem Ziel, gelingende Teamarbeit trotz Fachkräftemangel zu ermöglichen.
Wozu brauchen wir eigentlich Organisationen der Sozialen Arbeit?
Die Soziale Arbeit bzw. konkret Organisationen der Sozialen Arbeit fördern – so jedenfalls die Definition der Sozialen Arbeit – gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen (vgl. hier). Das ist hochgradig komplex.
Die Komplexität erhöht sich aber weiter, wenn die Arbeit „an der Basis“ in den Blick rückt:
Soziale Arbeit findet fast immer unmittelbar im direkten Kontakt mit den Menschen statt. Der direkte Kontakt jedoch ist kaum planbar und hoch individuell – jedes Kind ist anders, jede:r Jugendliche hat ihre individuellen Bedarfe, jeder Sozialraum ist anders. Das führt dazu, dass Mitarbeitende an der Basis der Sozialen Arbeit immer spontan entscheiden müssen. Sie agieren in “diffuser Allzuständigkeit” (vgl. hier, S. 166) zwischen den formalen und informalen Regeln, Mustern und Vorgaben der Organisation, den individuellen Anforderungen der Klient:innen und den Erwartungen der Gesellschaft.
Wie aber lassen sich Strukturen für diese hoch komplexen Arbeitswelten sinnvoll gestalten?
Strukturen funktional gestalten
Organisationsstrukturen dienen grundsätzlich dazu, Komplexität zu reduzieren. Das wird bspw. bei Stellenbeschreibungen deutlich. Hier ist geregelt, welche Aufgaben, wie lange und mit welchem Gehalt zu erledigen sind. Wenn jede:r Mitarbeiter:in täglich neu entscheiden würde, was, wie, wann und für welches Entgelt gearbeitet wird (oder auch nicht), wäre das Chaos vorprogrammiert.
Es lassen sich insgesamt vier “Bereiche formaler Strukturen” – sog. Entscheidungsprämissen – definieren, über die in Organisationen bewusst entschieden werden kann (vgl. näher z.B. hier):
- Ziele und Zwecke (Wozu sind wir da? Was wollen wir erreichen?) verdeutlicht z.B. über das Leitbild oder die Organisationsstrategien
- Entscheidungswege (Wer darf was entscheiden?) verdeutlicht z.B. über das Organigramm; Abteilungen, Teamstrukturen, Verantwortlichkeiten
- Regeln und Prozesse (Wenn A passiert, ist B zu tun!) verdeutlicht z.B. über QM-Prozesse; Festlegung von Zeiten für Teambesprechungen
- Personal (Welche Person übernimmt welche Aufgabe), verdeutlicht z.B. über Stellenprofile oder die Verteilung der Aufgaben innerhalb des Teams
Bis vor wenigen Jahren war es den Einrichtungen möglich, gute Personalentscheidungen bereits im Einstellungsverfahren zu treffen: Es wurde die Person eingestellt, die “am besten ins Team passt” oder “die eine zur Organisation passende pädagogische Haltung hat”. Auf diese Weise konnten motivierte, verantwortungsbewusste und fachlich kompetente Fachkräfte gewonnen und damit die Qualität gesichert werden. Diese Auswahlmöglichkeit ist in Zeiten des Fachkräftemangels kaum noch gegeben, da die Auswahl an geeigneten Personen sehr eingeschränkt ist (vgl. näher z.B. hier).
Da die Ziele und Zwecke oftmals klar sind (bzw. vom Team selbst nicht geändert werden können), folgt daraus, dass die Entscheidungswege (Zuständigkeiten) sowie die Regeln und Prozesse übrig bleiben, um darüber die Teamarbeit trotz Fachkräftemangel gelingend und damit “funktional” zu gestalten.
Fünf Schritte zur gelingenden Teamarbeit trotz Fachkräftemangel
Um eine möglichst hohe Qualität der erbrachten Leistungen zu gewährleisten, ist vor allem Klarheit auf allen Ebenen und in allen Rollen erforderlich. Dies wird erreicht durch Klarheit über das “Wozu” (Zweck der gemeinsamen Arbeit), die Erwartungen an Haupt- und Nebenrollen (Verantwortlichkeiten), den Verzicht auf Unnötiges und die Klärung von Regeln und Abläufen. Hilfreich sind die folgenden fünf Schritte:
- Das “Wozu” klären: Im ersten Schritt geht es darum, sich der gemeinsamen professionellen Grundhaltung bewusst zu werden und zu beschreiben, wozu es die Einrichtung gibt: Für wen sind wir da? Welchen Mehrwert wollen wir bieten? Wie machen wir das konkret? Neudeutsch spricht man hier vom „Purpose“, der ganz spezifisch für das Team und/oder die Einrichtung die Daseinsberechtigung beschreibt.
- Hauptrollen klären: Dann ist transparent zu machen, was von den Mitarbeitenden in ihrer jeweiligen Rolle (als Leitung, Erzieher:in, Kindheitspädagog:in, Kinderpfleger:in oder auch als ungelernte Kraft) erwartet wird. Sicherlich haben alle Erwartungen an die eigene Rolle und auch an die Rolle der anderen. Problematisch wird es, wenn die Erwartungen unklar sind und voneinander abweichen. Unausgesprochene, sogenannte informale Erwartungen führen zu Frustration – auf beiden Seiten. Deshalb braucht es klare Rollenbeschreibungen, in denen Aufgaben (Was genau ist in der Rolle zu tun?), Befugnisse (Was darf die Rolle entscheiden?) und Verantwortlichkeiten (Wofür ist die Rolle verantwortlich?) definiert sind.
- Nebenrollen klären: Der Versuch, den Betrieb trotz Fachkräftemangel aufrechtzuerhalten, führt häufig dazu, dass vor allem Leitungskräfte ihre Leitungsaufgaben vernachlässigen, um im pädagogischen Alltag “einzuspringen”. Dies wird sich nicht gänzlich vermeiden lassen. Durch die Klärung und Verschriftlichung der Erwartungen an die “Hauptrollen” (s.o.) wird deutlich, dass Aufgaben ggf. auch von anderen Mitarbeitenden übernommen werden können. Darüber hinaus ist es sinnvoll, einzelne Aufgaben in “Nebenrollen” (Mandate bzw. Verantwortungsbereiche) zusammenzufassen und zu festzulegen, wer im Team für das jeweilige Mandat verantwortlich ist, welche Aufgaben mit dem Mandat einhergehen und welche Entscheidungsbefugnisse im Mandat liegen.
- “Unnötiges” klären: Es wird nicht möglich sein, alle Aufgaben wie bisher weiterzuführen. Deshalb sollte auch Klarheit hergestellt werden über das, was nicht mehr leistbar ist. Hier hilft der Blick auf das Konzept der Exnovation – verstanden als Pendant zur Innovation und Grundlage jeder Weiterentwicklung. Hier geht es darum, Raum für Neues zu schaffen – oder vielleicht auch nur darum, konkrete Ansatzpunkte zu finden, was in Zukunft weggelassen werden kann, um überhaupt wieder Luft zum Atmen zu bekommen.
- Den Rest klären: Damit ist gemeint, zu beachtende ‘Grundregeln’ (Regeln und Prozesse) transparent zu machen. Das beginnt bei Zeiten für Teambesprechungen, geht über die Struktur der Besprechungen oder die Frage, wer moderiert und dokumentiert, bis hin zur Frage, wie Entscheidungen im Team getroffen werden. So werden Teamsitzungen effizienter, es ist klar, wer Protokoll schreibt, und es werden schnell gute und verbindliche Entscheidungen getroffen.
Das Team-Handbuch als Orientierung
Die Ergebnisse dieser Klärungen sollten in einem Team-Handbuch schriftlich festgehalten werden. Damit wird Orientierung für bestehende Mitarbeitende gegeben, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen erleichtert und Konflikte reduziert, da klarer zwischen Rolle und Person unterschieden werden kann: Statt die ganze Person zu kritisieren, kann die Kritik auf die Rolle fokussiert werden (Peter hat in seiner Rolle als Erzieher die formalen Erwartungen nicht erfüllt). Darauf aufbauend können konkrete Lösungen erarbeitet werden, wie die Rollenerwartungen in Zukunft besser erfüllt werden können.
Damit es praxistauglich bleibt, sollte das Team-Handbuch möglichst schlank gehalten werden. Außerdem ist es wichtig, dass die darin formulierten Leitlinien und Regeln der gemeinsamen Teamarbeit nicht “in Stein gemeißelt” sind, sondern regelmäßig (z.B. jährlich) aktualisiert werden. Denn Rahmenbedingungen ändern sich ebenso wie die Zusammensetzung des Teams und Regeln von gestern sind morgen nicht mehr unbedingt hilfreich. Deshalb sollte bereits bei der Erarbeitung und Verabschiedung des ersten Entwurfs vereinbart werden, wann genau eine Überprüfung und Überarbeitung ansteht.
Befreiende Strukturen für gelingende Teamarbeit – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels
Zusammenfassend ist der Fachkräftemangel nicht wegzudiskutieren und führt dazu, dass es immer schwieriger wird, genügend (und geeignetes) Personal für die eigene Einrichtung zu finden. Statt jedoch mit falsch verstandenen “New Work”-Maßnahmen und orientierungsloser Selbstorganisation um neue Mitarbeitende zu werben, plädieren wir für die Gestaltung klarer Strukturen der gemeinsamen Zusammenarbeit.
Diese Strukturen bilden den Rahmen, innerhalb dessen ein sicheres, vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander möglich wird, das von kontinuierlicher individueller und gemeinsamer Entwicklung geprägt ist. Teams in Organisationen der Sozialen Arbeit, die auf dieser Basis zusammenarbeiten, werden zu starken Teams und bieten – auch in Zeiten des Fachkräftemangels – beste Voraussetzungen für gute Arbeit.
Auf den ersten Blick scheint dies dem populären Verständnis von New Work zu widersprechen. Doch auf den zweiten Blick schaffen Strukturen Sicherheit – eine Sicherheit, die neue Freiheiten und Freiräume in der hochkomplexen Sozialen Arbeit ermöglicht.
Daraus können im besten Fall sogar neue Nischen entstehen, um neue Probleme wahrzunehmen und Raum für zukünftige Lösungen zu bieten.
P.S.: Hier findest Du unseren Podcast, in dem wir aktuell eine Staffel zum Thema Fachkräftemangel aufnehmen. Viel Spaß beim Hören!



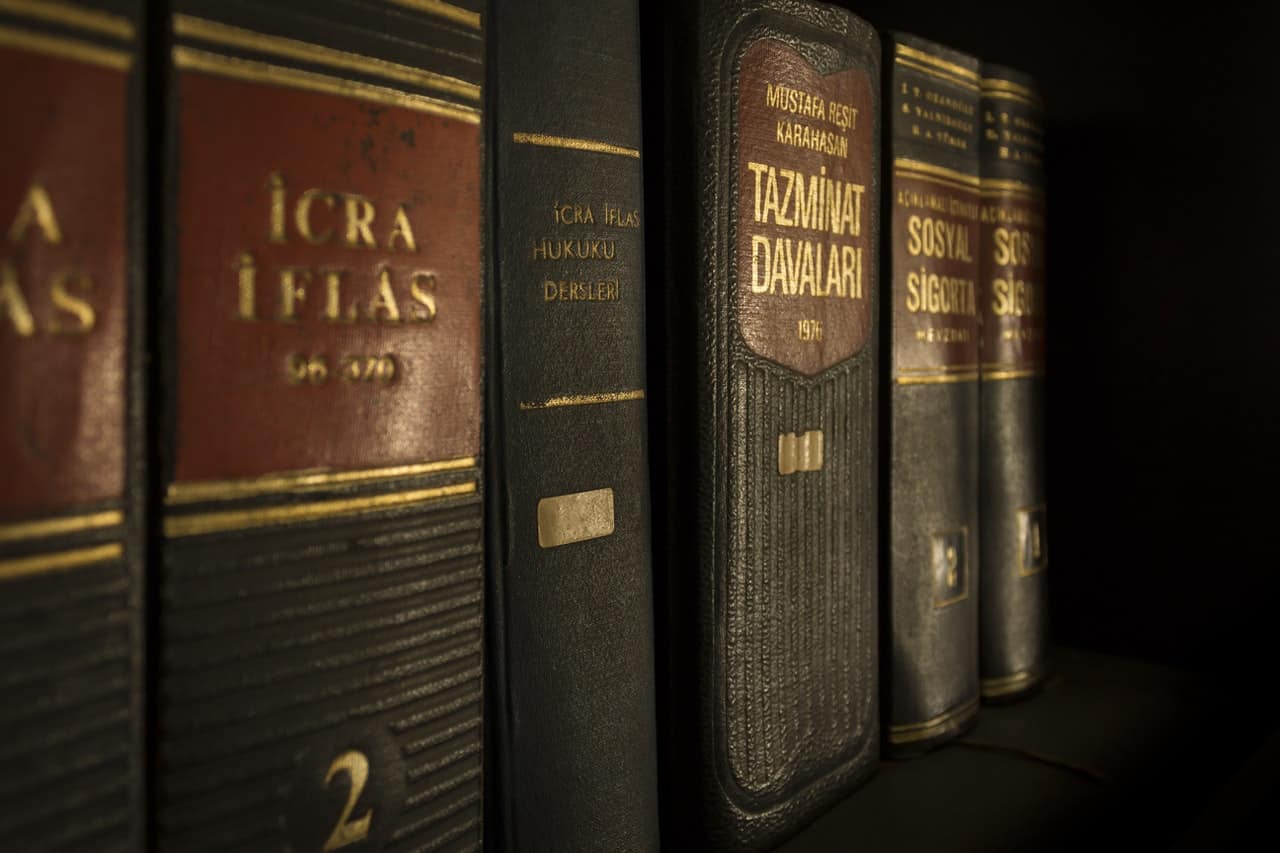
Neueste Kommentare