tl;dr: Neben der „clickbait Überschrift“ findest Du im Beitrag Basics rund um Strategie, Strategieentwicklung und Strategieumsetzung mit einem spezifischen Fokus auf Organisationen der Sozialwirtschaft. Am Ende findest Du die – aus meiner Sicht wirklich wichtigen – Fragen, die Du Dir stellen solltest, wenn Du Dich mit der Strategie Deiner Organisation befassen willst.
Strategie – schon der Begriff weckt Hoffnungen: Sie gibt die Richtung vor, verspricht Klarheit und Transparenz. Die Unternehmensstrategie soll – so eine Definition – als Navigationsprinzip zur Bewältigung von Komplexität dienen (vgl. Malik, 2017:91) – mit dem Ziel, das Überleben der Organisation (nicht nur) in Krisenzeiten zu sichern. Und aktuell, in den wahrlich herausfordernden Zeiten, habe ich das Gefühl, dass in Organisationen der Sozialwirtschaft händeringend nach einer „Strategie in der Krise“ gesucht wird und damit nach etwas, das mehr verspricht als ein „Stochern im Nebel“. Dabei ist – so mein Eindruck – zum einen oft unklar, was unter Strategie verstanden wird und zum anderen, wie genau eine Strategie entwickelt werden und vor allem, wie die Strategieumsetzung gelingen kann.
Mit dem folgenden Beitrag zu Strategie in der Sozialwirtschaft stochere ich selbst ein wenig im Strategienebel, in der Hoffnung, Orientierung geben zu können. Gleichzeitig lade ich aber auch dazu ein, den Nebel einer ungewissen Zukunft proaktiv anzunehmen und gerade dadurch Gestaltungsfreiheit zu gewinnen.
Im Folgenden skizziere ich zunächst meinen aktuellen Eindruck von den Problemen, die hinter der (teilweise) berechtigten Suche nach einer Strategie in der Krise stehen, um darauf aufbauend einen Einblick in aktuelle Grundlagen rund um Strategieentwicklung und Strategieumsetzung zu geben. Abschließend versuche ich auf dieser Basis einige Handlungsoptionen für Organisationen der Sozialwirtschaft zu skizzieren, die Dir und Deiner Organisation hoffentlich etwas Orientierung auf der Suche nach Orientierung geben können.
Und falls Du Dich für weitere Beiträge rund um Strategie und Co. interessierst, findest Du zum Beispiel hier einen Beitrag mit dem Fokus auf agile Strategieentwicklung und -umsetzung und hier einen Beitrag zur adaptiven Strategiearbeit in Sozialen Organisationen mit Ausführungen für Ansätze, Herausforderungen und Lösungen.
Strategie in der Krise oder Krisenstrategien?
Du merkst schon in der Einleitung, dass ich mich vorsichtig ausdrücke. Ich schreibe nicht davon, dass ich – trotz einiger, erfolgreich durchgeführter Projekte – das eine Rezept habe, mit dem Strategieentwicklung immer gelingt. Ich schreibe nicht davon, dass ich den Stein der Weisen gefunden haben und damit den einzig wahren Weg, um Klarheit, Orientierung und Transparenz für dich und deine Organisation auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft zu gewinnen.
Das ist aus Marketingsicht schlecht.
Du suchst nach Antworten und ich antworte vage. Ich biete Dir kein „Strategierad“ an, das Dir die strategischen Themen vorgibt. Ich sage auch nicht, dass das Durchlaufen der sehr hilfreichen Strategie-Schleife (vgl. Nagel, 2014) der Königsweg ist. Ich stochere häufig genauso im Nebel wie du. Das ist für mein „strategisches Marketing“ – wie gesagt – alles andere als gut. Denn aus Vertriebssicht hilft es viel mehr, einfache, wenn auch oft falsche Antworten auf komplexe Fragen zu geben.
Und die Fragen sind nicht nur komplex, sondern auch paradox. Entweder-oder-Entscheidungen sind bei vielen Themen kaum möglich. An vielen Stellen geht es um ein „sowohl als auch“ und damit – eben – um Nebel.
Gleichzeitig, und das ist der Ausgangspunkt dieses Beitrags, stelle ich fest, dass gerade in den aktuell (wieder einmal) herausfordernden Zeiten viele Menschen und Organisationen auf der Suche nach Antworten sind, um wieder zu einer wie auch immer gearteten Sicherheit zu gelangen. Und da kommen Strategien ins Spiel.
Um nur drei Beispiele herauszugreifen geht es
- in der „neue caritas“ (Ausgabe 06/25, siehe hier) übergreifend um das Thema Strategie.
- im Leitartikel der „sozialwirtschaft aktuell“ (Erlinghagen, 05/2025) – etwas reißerisch – um „Organisationen der Sozialwirtschaft in Zeiten kollabierender Systeme“. Dabei beschreibt der Beitrag „einige absehbare Entwicklungen, begründet, warum wir uns mit dem Phänomen kollabierender Systeme auseinandersetzen, und geht der Frage nach, was das für Unternehmen der Sozialwirtschaft im Speziellen bedeutet“ (ebd.), womit er – zumindest aus meiner Sicht – viel mit dem Thema Zukunft und Strategie zu tun hat. So kommt der Autor auch passenderweise zum Schluss: „Solange Kollapsphänomene ignoriert oder als Ausnahmezustände betrachtet werden, sind tiefergehende Anpassungsstrategien nicht vorstellbar“ (ebd., 3).
- im Beitrag von Anja um „Lebenslanges Lernen in Zeitenwenden: Überlebensstrategien für eine Welt im Umbruch“. Ja, dieser Beitrag ist nicht spezifisch auf die Sozialwirtschaft und auch nicht (nur) auf Organisationen bezogen. Aber der Untertitel – „In einer Zeit radikaler Veränderungen sind lebenslanges Lernen und Anpassungsfähigkeit entscheidend. Wie werden wir fit für unsere gemeinsame Zukunft?“ – hat mich – neben dem Strategieaspekt – doch sehr an die Herausforderungen von Organisationen der Sozialwirtschaft erinnert. Etwas abgewandelt:
Wie werden Organisationen der Sozialen Arbeit fit für eine gemeinsame Zukunft – und (wie) kann die Strategie in der Krise bei der Beantwortung der Frage helfen?
Basics der Strategieentwicklung und -umsetzung
Aber was ist Strategie im Kontext von Organisationen und Unternehmen eigentlich?
Das ist, wie auch Nagel (2014) schreibt, „oft unklar“. Es „hat sich bis heute keine allgemeinverbindliche Definition von ‚Strategie‘ durchgesetzt“ (ebd.).
In der Strategiearbeit geht es aber, so viel als gemeinsame Basis, um Fragen, die für die Organisation überlebensrelevant sind.
Zur weiteren Eingrenzung ist die Unterscheidung in die drei Ebenen des normativen, strategischen und operativen Managements – angelehnt an das St. Galler Management-Modell – hilfreich:
Während sich das normative Management mit den unternehmenspolitischen Wert- und Interessenkonflikten aller Beteiligten auseinandersetzt (Was sind unsere Grundwerte?) und das operative Management als die unmittelbare Steuerung wiederkehrender Prozesse und konkreter Strukturen zur Erbringung von (Dienst-)Leistungen verstanden werden kann, beschäftigt sich das strategische Management mit Entscheidungen zu komplexen Problemen qualitativer Art, wie z.B. der Bewältigung zukünftiger Marktbedingungen und/oder Exnovations- bzw. Innovationspotenziale der Organisation (vgl. Grunwald, 2022:9).
Hier kann die Frage „Welche zentralen Themen/Ziele/Möglichkeiten verfolgen wir (und welche auch nicht) in den nächsten Jahren?“ Orientierung geben.
Gibt es Kriterien für strategische Themen?
Wichtig ist, dass die Entscheidungen zu Problemen qualitativer Art (oder kürzer: die übergreifenden strategischen Themen/Optionen) langfristig (nicht kurzfristig), folgenreich (nicht beliebig), funktionsübergreifend (nicht spezifisch) und komplex (also nicht trivial) sind.
Diese vier Aspekte können gut als grobe Kriterien für die Überprüfung der eigenen strategischen Entscheidungen bzw. der auf den Entscheidungen basierenden strategischen Ziele herangezogen werden. Und wenn Du jetzt auf die (hoffentlich vorhandene) Strategie Deiner Organisation schaust:
Sind die formulierten strategischen Optionen
- langfristig,
- folgenreich,
- funktionsübergreifend und
- komplex?
Um es konkret zu machen ist die strategische Option „Ausweitung des Marktportfolios“
- langfristig (Planung, Finanzierung, Personalaufbau → oft über Jahre),
- folgenreich (Verändert Reichweite, Zielgruppen und Ressourcenstruktur),
- funktionsübergreifend (Pädagogik, Verwaltung, Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit) und
- komplex (gesetzliche Rahmenbedingungen, Bedarfsanalysen, Personalgewinnung…).
Das wird bspw. greifbar, wenn es um die Eröffnung eines neuen Standorts, einer neuer Einrichtung oder eines neuen Arbeitsfelds geht.
Im Gegensatz dazu ist – logisch – die Anschaffung neuer Möbel für ein Gruppenangebot keine strategische Entscheidung, da diese nur eine geringe Tragweite hat, kaum funktionsübergreifend ist und primär Sachmittel und nicht die inhaltliche Ausrichtung betrifft.
Entscheidungen treffen
Deutlich wird:
Es geht um das Treffen von – in dem Fall strategischen – Entscheidungen. Das sind Entscheidungen „zu den zu erbringenden Leistungen und zu den Modalitäten der künftigen Leistungserbringung. Dies zieht Nachfolgeentscheidungen zum Personal (…) und zu den Kommunikationswegen (…) nach sich, jedoch geht solchen Entscheidungen die basale Entscheidung zu den Programmen voraus“ (Merchel, Gesmann, 2021:305).
Angelehnt an Heinz v. Förster sind Entscheidungen jedoch immer Entscheidungen des prinzipiell Unentscheidbaren (vgl. Teil der Welt, S. 67 f.). Klingt komisch, heißt aber nur:
Wäre A besser als B, würden wir natürlich A nehmen – alles andere wäre blöd. Entscheiden ist hier nicht notwendig. Dann aber, wenn A und B gleichwertig sind, braucht es die Entscheidung.
A und B klingt einfach, sind auf Ebene der strategischen Entscheidungen jedoch die Optionen, die für die Organisation (Überlebens-)Relevanz haben:
Einrichtung eröffnen oder aufgrund des Fachkräftemangels das Portfolio fokussieren? Lobbyarbeit stärken oder die Ressourcen in den Ausbau des digitalen Marketings stecken? Formale Hierarchien abflachen und eher Richtung agiler Selbstorganisation oder formale Hierarchien stärken und eher in Richtung Klarheit und Orientierung gehen?
Strategieumsetzung
Noch einmal: Echte Strategien sind mehr als rein auf finanzielle Planungen ausgerichtete Plattitüden.
Sie lassen sich – eine andere Definition – als Navigationsprinzipien für das Bewältigen von Komplexität (vgl. Malik, 2017:91) definieren und verfolgen den Zweck, das Überleben der Organisation in Zeiten des Wandels sicherzustellen.
Einführend lohnt sich ein Blick auf Muster und damit auf Vorgehensweisen der Strategieumsetzung, die sich in Organisationen immer wieder zeigen. Grob lassen sich vier Muster unterscheiden;
- Der:die Chef:in entscheidet intuitiv (das erinnert ein wenig an den Zollidioten aus Amerika, bei dem man nie weiß, was morgen kommt).
- Strategiearbeit wird an „Expertinnen“ wie Beratungsunternehmen oder auch Stabsstellen in Unternehmen ausgelagert.
- Strategiearbeit passiert – positiv formuliert – evolutionär (negativ formuliert wurschtelt man sich so durch, da man ja nie wissen kann, was morgen ist).
- Strategiearbeit geschieht systemisch als gemeinsame Führungsaufgabe.
Optimal wäre natürlich eine systemische Strategiearbeit, die neben den Führungskräften auch die Mitarbeitenden mit einbezieht und ihnen vermittelt, dass sie mit ihrer Arbeit einen Beitrag zur (Weiter-)Entwicklung der Gesamtorganisation leisten. In meinen eigenen Begleitungen von Strategieprozessen versuche ich diesen Weg zu gehen, was hoffentlich in den Ausführungen hier deutlich wird bzw. geworden ist. Und ja, manchmal haben auch die anderen drei Muster zu Teilen ihre Berechtigung: Manchmal macht es Sinn, dass top-down entschieden wird, manchmal hilft es, Expert:innen einzubinden und manchmal ist man im Nebel unterwegs und bewegt sich „evolutionär“ voran.
Wieder zurück zur Strategieumsetzung in Zeiten des Wandels: Selbst wenn die Marktdynamik in der Sozialwirtschaft nicht so ausgeprägt ist wie in der freien Wirtschaft, so haben wir doch – organisationsintern wie -extern – gerade genug Dynamik und damit Wandel, oder?
Spätestens hier wird es aber herausfordernd, denn die fundierte Strategieentwicklung, die in einen Plan führt, der nur noch checklistenartig umzusetzen ist, macht keinen Sinn. Dafür sind zum einen die hybriden, meist dezentral strukturierten Organisationen der Sozialwirtschaft viel zu komplex. Zum anderen kommt die Komplexität und Dynamik der (Um-)Welt hinzu – oft diskutiert als „VUKA-Welt“.
Entsprechend reicht es nicht, alle 5 Jahre auf das damals erarbeitete Strategiepapier zu schauen und mal eben neu auszurichten, um dann wieder fünf Jahre weiterzumachen wie bisher.
Nach der Entwicklung steht somit die Frage im Zentrum:
- Wie können strategische Entscheidungen umgesetzt werden, wenn – Achtung, Binse – das einzig Sichere der Wandel ist?
Dazu präferiere ich einen Weg, der sich grob als „agile Strategieumsetzung“ beschreiben lässt.
Darunter verstehe ich, dass nach der Entscheidung für strategische Optionen und der Beschreibung der Ziele, die sich hinter den Optionen verbergen, gemeinsam überlegt wird, welche Projekte initiiert werden können, die einen Beitrag zu den Optionen leisten.
Strategieverantwortliche
Um die Strategie der Gesamtorganisation projektbezogen angehen zu können, ist es relevant, dass sich jeweils ein/e Verantwortliche/r für eine strategische Option findet und sich für das Thema „den Hut aufsetzt“. Hilfreich ist es, wenn die „Strategieverantwortlichen“ in der formalen Hierarchie möglichst hoch „aufgehängt“ sind (bspw. zweite Führungsebene), um dem jeweiligen strategischen Thema die notwendige Durchsetzungskraft zu verleihen.
Die Strategieverantwortlichen sind dann gefordert, sich ein interdisziplinäres und hierarchieübergreifendes „Strategieteam“ zu suchen, um erste Ideen für strategische Projekte zu generieren. Sie sind nicht unmittelbar operativ, sondern zum einen für die Zusammensetzung und das Funktionieren der Projektteams verantwortlich. Zum anderen besteht die Gefahr, dass ohne klare Verantwortlichkeiten Unsicherheiten entstehen, wer für welches strategische Projekt zuständig ist.
Strategische Projekte
Die Suche nach ersten Ideen für strategische Projekte kann und sollte auch darauf basieren, was in der Organisation aktuell bereits an Projekten läuft, die sich den entsprechenden strategischen Optionen zuordnen lassen. So wird ggfs. die strategische Option „Digitalisierung sinnvoll nutzen“ definiert. Aller Wahrscheinlichkeit nach laufen aber bereits Projekte rund um das Thema Digitalisierung, vielleicht experimentieren einige Bereiche und Abteilungen bereits mit KI-Anwendungen, andere Bereiche testen und nutzen bereits Technik im Kontext von AAL.
Kurz: Projekte müssen nicht unbedingt „neu“ sein. Es können auch bestehende Projekte zukunftsorientiert weitergeführt werden – allerdings nicht mehr isoliert und unverbunden, sondern unter dem Dach der Strategie vernetzt und mit einem ganzheitlichen Blick auf die Gesamtorganisation.
Regelmäßige Retrospektiven
Wichtig ist, dass die Strategieverantwortlichen in regelmäßigen Abständen – z.B. alle vier Monate – über den Stand und die Entwicklung der jeweiligen Projekte in den Führungsrunden berichten. Der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand obliegt es dann – im Sinne eines „Product Owners“ und idealerweise gemeinsam mit dem Leitungsteam – zu entscheiden, ob und in welcher Form die angestoßenen Projekte mit welchen Ressourcen weiterverfolgt werden sollen.
Mit diesem Vorgehen gelingt es, Fehlentwicklungen zu vermeiden, knappe Ressourcen bedarfsgerecht zu steuern und die Strategieumsetzung nicht losgelöst von aktuellen Entwicklungen zu betrachten. Ideal ist, wenn es gelingt, nicht nur auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, sondern diese aktiv in die Strategieumsetzung einzubeziehen. In meiner – vielleicht etwas naiven – Traumvorstellung bewegen wir uns damit in einer „Effectuation-Logik“:
Unvorhergesehene Entwicklungen werden nicht als „Angriff auf die strikte Planung der Strategieumsetzung“ verstanden („Auch das noch!“), sondern als Möglichkeit und Chance, die für die jeweilige strategische Option bzw. das jeweilige Projekt gewinnbringend genutzt werden kann. Eine entsprechend flexible Reaktion auf Veränderungen ist hier nicht nur unvermeidlich, sondern sogar erwünscht.
Regelmäßige Retrospektiven sind aber nicht nur auf der obersten Ebene zu etablieren, sondern – fast selbstverständlich, oder? – auch in den Projektteams selbst, die an der Umsetzung der Strategie arbeiten:
Auch hier gilt es, in regelmäßigen, kurzen Abständen innezuhalten und zu überlegen, ob die laufenden Projekte auf dem richtigen Weg sind, ob sie modifiziert oder gar eingestellt werden müssen – weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, weil amerikanische oder russische Freaks absurde Entscheidungen getroffen haben oder weil irgendwelche Viren sich überlegt haben, die nächste Pandemie auszulösen. Mit anderen Worten:
Auch in der konkreten Projektarbeit können sich die Bedingungen ändern – aus welchen Gründen auch immer. Statt am Plan festzuhalten, muss immer wieder gemeinsam neu entschieden werden, ob und wie es weitergeht.
Strategische Projektsteuerung
Angenommen, eine Organisation hat sechs strategische Optionen erarbeitet und für jede Option Strategieverantwortliche gefunden. Diese beginnen nun, „strategische Projekte“ zu initiieren. So weit, so gut.
Die Gefahr, dass es zu einer unkoordinierten Vielzahl von Projekten kommt, die wiederum unverbunden nebeneinander stehen, wird aber sofort deutlich.
Um dieser Gefahr zu begegnen ist neben den bereits erwähnten regelmäßigen Retrospektiven auf Leitungsebene, die den Raum für Entscheidungen über die Neuaufnahme, Anpassung oder – auch wenn es manchmal weh tut – Beendigung von Projekten bieten, die Etablierung einer „strategischen Projektsteuerung“ hilfreich.
Vor allem in großen Komplexträgern der Sozialwirtschaft werden hierfür häufig Stabsstellen eingerichtet. In kleineren Organisationen ist es sinnvoll, die Rolle der Projektsteuerung zu definieren und in bestehende Strukturen zu integrieren.
Aus meiner Sicht geht es bei der strategischen Projektsteuerung aber nicht nur darum, den Überblick über Projekte und Ressourcen zu behalten. Sinnvoller ist es, die strategische Projektsteuerung – im Sinne eines „Scrum Masters“ oder „Agile Coaches“ – auch für die Begleitung der einzelnen, temporär zusammengesetzten Projektteams zu nutzen.
Ziel dabei ist es, die Projektteams unter den ohnehin herausfordernden Arbeitsbedingungen zu unterstützen, möglichst schnell arbeitsfähig zu werden, effektiv und effizient ergebnisorientiert zu agieren und der Gefahr zu begegnen, dass Projektteams zu „Arbeitskreisen“ werden, die existieren, weil sie schon immer existiert haben.
Weglassen nicht vergessen
Die bisherigen Ausführungen klingen so, als wäre Strategieentwicklung und -umsetzung immer die Arbeit am „mehr“, an neuen strategischen Optionen mithilfe neuer Projekte, die von in der Sozialwirtschaft sowieso mehr als überlasteten Menschen verantwortet und von Teams umgesetzt werden, die nicht wissen, woher die zeitlichen und finanziellen Ressourcen dafür kommen sollen.
Hier hilft zum einen Michael Porter, der (in diesem Beitrag) schrieb, dass „Die Essenz der Strategie (…) darin [besteht] zu entscheiden, was nicht zu tun ist!“ Oder anders ausgedrückt:
Alles geht nicht! Denn wenn alles ginge, bräuchte es keine Entscheidungen und damit auch keine Strategie.
Zum anderen hilft ein Blick auf den Begriff der Exnovation im Sinne der gezielten, bewussten Reduktion oder Abschaffung von Produkten, Technologien, Prozessen, Praktiken, Institutionen oder Strukturen (vgl. Bils, Töpfer, 2024:223).
Wie wäre es, wenn in der Strategie Deiner Organisation strategische Option definiert wäre, die Exnovation explizit in den Mittelpunkt stellt:
„Wir reduzieren gezielt nicht mehr sinnvolle Produkte, Technologien, Prozesse, Praktiken oder Strukturen. Wenn möglich und sinnvoll, schaffen wir sie ganz ab. Dabei ist uns bewusst, dass Abschaffen auch bedeuten kann, Alternativen zu entwickeln.“
Exnovation ist also – dies nur als kleiner Hinweis – ohne Innovation nicht denkbar.
Exkurs: Bereichs- oder Abteilungsstrategien als Alternative zur „projektbasierten, agilen Strategieumsetzung“?
Alternativ zu der hier skizzierten „projektbasierten, agilen Strategieumsetzung“ erlebe ich häufig, dass „Teilstrategien“ entwickelt werden:
Es wird z.B. in einem Komplexträger der Eingliederungshilfe für eine Abteilung – z.B. dem Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderung – eine „Teilstrategie“ erarbeitet, die dann auf die Teams in den jeweiligen Bereichen „heruntergebrochen“ bzw. von den Teams umgesetzt wird bzw. werden soll.
Der Vorteil ist, dass die oftmals sehr abstrakte Gesamtstrategie für die Mitarbeitenden vor Ort deutlich greifbarer wird. So wird bspw. in der Gesamtstrategie die strategische Option „Personal und Führung – professionell gestalten!“ verabschiedet und ggfs. noch mit ein paar Sätzen hinterlegt. Die unmittelbare Übertragung des abstrakten Themas auf den eigenen Bereich ist schwierig.
Wenn aber – um im Beispiel zu bleiben – im Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderung die zu dieser strategischen Option heruntergebrochene Bereichsstrategie „Förderung der Mitarbeiterbindung!“ (Oder wie auch immer) lautet, ist ein „Andocken“ deutlich leichter möglich: Wie können wir im Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderung die Mitarbeiterbindung erhöhen?
Problematisch sehe ich jedoch, dass es sich bei Bereichs- oder Abteilungsstrategien nicht mehr um die Gesamtstrategie der Organisation handelt. Der Fokus verschiebt sich auf den eigenen Bereich.
Dem Wunsch nach „siloübergreifender Zusammenarbeit“ kann damit natürlich nicht mehr begegnet werden: Der Anreiz, gemeinsam an der Strategie für die Gesamtorganisation zu arbeiten, entfällt: „Ich arbeite an meiner Strategie für meinen Bereich. Was die anderen machen, interessiert mich nicht.“ Ja klar, das ist etwas radikal formuliert, trifft aber häufig zu und ist aus Perspektive der jeweils verantwortlichen Rolle (bspw. Bereichsleitung) völlig nachvollziehbar.
Das führt auch dazu, dass – sofern dennoch an der Gesamtstrategie der Organisation gearbeitet werden soll – der Koordinationsaufwand deutlich steigt, da Abstimmungen mit anderen Bereichen und Abteilungen schwierig, zeitintensiv und häufig konfliktträchtig sind.
Kurz: Auch hier zeigt sich, dass jede Problemlösung Lösungsprobleme erzeugt – jede Vorgehensweise hat Vor- und Nachteile. Wenn aber in den sowieso sehr dezentral strukturierten, lose gekoppelten Organisationen der Sozialwirtschaft der Wunsch nach einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung, der Wunsch nach mehr Identität oder der Wunsch nach interdisziplinären Zusammenarbeit und einem „voneinander Lernen“ besteht, liegen die Vorteile aus meiner Perspektive eher auf Seiten der projektbasierten, agilen Strategieumsetzung.
Strategie in der Krise entwickeln und umsetzen: Die 8 wichtigsten Fragen für Organisationen der Sozialwirtschaft
Hast Du geschafft, bis hierhin dranzubleiben? Respekt, denn es ist doch mehr geworden, als ursprünglich gedacht. Aber halbe Sachen sind auch doof.
Jetzt aber meine „10 wichtigsten Fragen“ rund um die Stratehieentwicklung und -umsetzung, die Du Dir vor und während der Strategiearbeit immer stellen solltest:
1. Was verstehst Du und Deine Organisation unter „Strategie“?
Dem folgend, dass es keine einheitliche Definition von Strategie gibt kannst Du auch nicht davon ausgehen, dass alle Menschen in Deiner Organisation ein einheitliches Verständnis von Strategie haben.
Vor der eigentlichen Strategiearbeit, vor der Strategieentwicklung und -umsetzung also, ist ein gemeinsames Verständnis darüber herzustellen, was ihr unter Strategie versteht.
2. Ist es Dir und Deiner Organisation mit der Strategiearbeit ernst?
Organisationen brauchen eine Strategie, oder?
Mitarbeitende suchen nach Orientierung und wollen wissen, „wo es denn hingeht“, was die größere Linie ist. Genauso beschäftigen sich Führungskräfte gerne in netten Locations, abgekoppelt vom anstrengenden Alltag, mit Fragen der Zukunft. Denn die Zukunft ist – frei nach dem Reiseesel Mallorca – immer da, wo man gerade nicht ist. Du merkst mein Augenzwinkern, aber:
Strategiearbeit, insbesondere der oben beschriebenen Vorgehensweise, macht nur dann Sinn, wenn es ernst wird. Nur dann, wenn wirklich der Wunsch nach gemeinsamem Lernen, nach Entwicklung und partizipativer Umsetzung von Entscheidungen existiert, lohnt sich das „systemische Vorgehen“.
Wie oben geschrieben, ist die „evolutionäre Strategiearbeit“ aka Durchwurschteln deutlich einfacher ebenso wie das Treffen von emotional gesteuerten Top-Down Entscheidungen durch den:die Chef:in oder das Auslagern der Strategie an Expert:innen. Denen kann man dann zumindest die Schuld in die Schuhe schieben, dass es doch nicht so gekommen ist, wie geplant.
Kurz: Ist es Dir und Euch ernst?
3. Ist Strategiearbeit für Dich und Deine Organisation notwendig?
Ist das nicht die gleiche Frage wie oben? Nicht ganz. Bei der Frage nach dem Ernst ging es mir um die Herangehensweise. Hier geht es mir um die Frage, ob Du und Deine Organisation tatsächlich „Not wenden“ muss?
Not wenden – die Notwendigkeit – fokussiert darauf, dass Strategiearbeit wenig Sinn macht, wenn es nicht um wirklich (Überlebens-)Notwendiges geht. Denn dafür ist Strategie, dafür sind strategische Entscheidungen da:
Das Überleben der Organisation in Zukunft zu sichern.
4. Wer profitiert vom Status Quo?
„Wer will Veränderung?“ – Alle Hände gehen hoch.
„Wer will sich verändern?“ – Du kennst die Grafik vermutlich.
Deutlich wird dabei, dass es – auch wenn Strategie für Dich und Deine Organisation notwendig ist und auch wenn klar ist, was ihr unter Strategie versteht – Menschen in der Organisation gibt, die in ihrer Rolle vom aktuellen Zustand profitieren. Die einfache Zuschreibung, dass doch alle bei jeder noch so sinnvollen Veränderung „Widerstand“ aufbringen, reicht hier nicht aus. Die Zuschreibung verändert nichts.
Hilfreicher ist, sich schon vor oder zumindest während der Strategieentwicklung bewusst zu werden, wer warum vom Ist-Stand der Organisation profitiert. Dann wird es möglich, gezielt die Bedenken und Befürchtungen zu thematisieren und Veränderung – zumindest besser – gelingen zu lassen.
5. Wer hat welche Erwartungen an den Strategieprozess?
In eine ähnliche Richtung zielt auch die Frage nach den Erwartungen:
Erst wenn ein klareres Bild davon existiert, wer welche Erwartungen an den Strategieprozess hat, wird eine gemeinsame Arbeit an der Strategie und die Umsetzung strategischer Projekte wahrscheinlicher.
Dabei sind vor allem die informalen Erwartungen, also die Erwartungen, die verdeckt sind, interessant und gleichzeitig schwer zu thematisieren. Allein aber die Reflexion über die Frage, wer welche Erwartungen hat, kann befreiend sein, da überhaupt in diese Richtung gedacht wird.
Um näher an die informalen Erwartungen heranzukommen, hilft die Thematisierung dessen, was nach dem Strategieprozess aus Perspektive der Beteiligten anders sein soll als heute oder danach, was im Strategieprozess auf keinen Fall passieren soll.
6. Hast Du und Deine Organisation alles, was ihr braucht?
Dahinter verbirgt sich die Frage nach den Personen, die aktiv an der Strategieentwicklung und später verantwortlich an der Strategieumsetzung beteiligt sind:
- Verfügen die Personen, die sich mit der Strategie befassen, über inhaltliche Kompetenzen, um die anstehenden Fragen kompetent beurteilen zu können?
- Haben sie die Kompetenz, die Methoden, Instrumente und Verfahren auszuwählen und anzuwenden?
- Können sie mit eventuell auftretenden schwierigen und konfliktreichen Situationen umgehen?
- Haben sie die Zeit und das persönliche Engagement, sich dem Strategieprozess so zu widmen, wie es erforderlich ist oder werden könnte?
Zwei konkrete Beispiele:
Bei einem Kunden erarbeite ich gerade einen „Crashkurs Strategiearbeit“, in dem es darum geht, allen Führungskräften zumindest über die grundlegenden Kompetenzen der in dieser Organisation angestrebten Strategiearbeit an die Hand zu geben. Ich finde das wunderbar, denn so ist zumindest ein gemeinsames Grundgerüst gegeben, auf das immer wieder zurück gegriffen werden kann. Eine andere Organisation hat ein Programm ins Leben gerufen, dass die Arbeit in Projekten thematisiert, um so in der Gesamtorganisation das Thema Projektmanagement zu verankern.
Ja, das ist Aufwand. Und nein, es ist nicht sichergestellt, dass alle Projekte zum Erfolg führen und die Strategien umgesetzt werden. Aber zu hoffen, dass es auch so irgendwie klappt, ist sicher noch weniger erfolgsversprechend.
7. Wie kommunizierst Du die Arbeit an der Strategie von Beginn an?
Organisationen der Sozialwirtschaft sind komplexe soziale Systeme mit vielen Mitarbeitenden. Da ist es klar, dass nicht alle Mitarbeitenden in gleicher Weise in die Strategiearbeit eingebunden werden können. Nicht alle Mitarbeitende können in Workshops involviert sein, können strategische Optionen erarbeiten, Projektideen aufsetzen oder sich in Projektteams an strategischen Projekten beteiligen.
Entsprechend wichtig ist es, von Beginn an zu überlegen, wer wann wie eingebunden wird, wer wann über welchen Weg informiert wird, wer wann wie beteiligt wird usw.
Es wäre naiv – aber das wurde deutlich, denke ich – im stillen Kämmerlein eine noch so toll klingende Strategie zu erarbeiten, diese auf Hochglanzpapier zu veröffentlichen und dann zu glauben, dass Mitarbeitende die Strategie kennen geschweige denn sich dieser auch nur ansatzweise verbunden fühlen.
8. Brauchst Du und Deine Organisation alle fünf Jahre eine neue Strategie?
Hier bin ich unschlüssig:
Einerseits macht es durchaus Sinn, regelmäßig aus dem Alltag auszusteigen und zu überlegen, was in Zukunft für die eigene Organisation überlebenswichtig sein wird. Genau dazu dienen ja die „Strategieklausuren“.
Aus der oben skizzierten „agilen Strategieumsetzung“ ergibt sich jedoch die Notwendigkeit, kontinuierlich über die Zukunft nachzudenken.
Ernsthaft umgesetzt sollte jede Retrospektive der Leitungsrunde einen Blick in die Zukunft werfen: Sind die laufenden Projekte noch sinnvoll? Wo müssen sie angepasst werden? Was kann und muss weg? Und darüber hinaus plädiere ich eher für regelmäßige, z.B. jährliche Überprüfungen, ob die strategischen Optionen noch den aktuellen Bedürfnissen entsprechen.
Das hat zur Folge, dass nicht mehr alle paar Jahre eine gesonderte Strategieentwicklung notwendig ist, sondern die Strategiearbeit und auch die Anpassung der strategischen Optionen an die aktuellen Bedingungen kontinuierlich erfolgt.
Nebeneffekt ist, dass die Strategie so kontinuierlich auf dem Schirm der Organisation bleibt und nicht nach fünf Jahren, kurz vor dem nächsten Strategiezyklus, hektisch hervorgeholt wird – mit der Feststellung, dass wir eigentlich nicht weitergekommen sind.
Strategie in der Krise – ein ganz kurzes Fazit
Strategie- komplexes Thema, was sich in einem definitiv zu langen Blogbeitrag zeigt. Aber ich hau den trotzdem raus.
Denn meine Hoffnung ist, dass Du darin vielleicht den einen oder anderen Hinweis findest, der Dich in Deiner Strategiearbeit weiterbringt. Und vielleicht hilft es Dir ja auch, über die Fragen am Ende nachzudenken und eigene Antworten für Dich und Deine Organisation zu finden.
Hilfreich für mich wäre aber zu erfahren, was Deine Erfahrungen mit Strategiearbeit in Organisationen der Sozialwirtschaft sind?
Lass dazu doch gerne einen Kommentar da oder schreib mir gerne – würde mich sehr freuen.
Quellen:
- Bils, S., Töpfer, G. (2024): Exnovation und Innovation. Synergie von Ende und Anfang in Veränderungen. Schäffer Poeschel.
- Gesmann, S., Merchel, J. (2021): Systemisches Management in Organisationen der Sozialen Arbeit. Carl-Auer.
- Grunwald, K. (2022): Management sozialwirtschaftlicher Organisationen: Eine Einführung. Springer VS.
- Nagel, R. (2014): Lust auf Strategie: Workbook zur systemischen Strategieentwicklung. aktualisierte Auflage. Schäffer Poeschel.
- Nagel, R., Wimmer, R. (2014): Systemische Strategieentwicklung: Modelle und Instrumente für Berater und Entscheider. 6. Auflage. Schäffer Poeschel.
- Malik, F. (2017): In: Roehl, H., Asselmeyer, H.: Organisationen klug gestalten. Das Handbuch für Organisationsentwicklung und Change Management. Schäffer Poeschel.








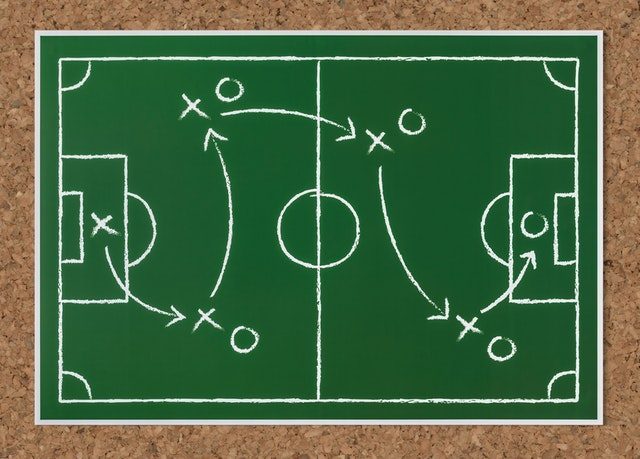



Neueste Kommentare