Als eine Art Präambel schicke ich dem Beitrag eine Warnung vorweg: Er passt nicht in die Kategorie „Blogbeitrag“, denn ich liefere keine einfachen „Handlungsschritte“. Vermutlich entspricht er auch nicht der Logik von Beiträgen, die „schnell und gut“ gefunden werden, sei es durch Suchmaschinen oder KI. Außerdem ist der Beitrag bewusst ausführlich, wahrscheinlich sogar zu ausführlich. Er ist eher eine Standortbestimmung als eine Checkliste und somit die Verschriftlichung meiner „Beobachtungen vom Beckenrand“. Mit diesen möchte ich selbst reflektieren und einen Dialog ohne vorschnelle Vereinfachungen ermöglichen. Der Beitrag verfolgt die These, dass zunehmende Krisenerfahrungen in Organisationen der Sozialen Arbeit nicht auf das Versagen einzelner Akteure – ob Menschen oder Organisationen – zurückzuführen sind, sondern vielmehr Ausdruck dauerhaft überlasteter und damit zunehmend brüchiger Kopplungen in der Sozialen Arbeit zwischen nicht mehr funktionierenden Kostenträgern und den ebenfalls hoch belasteten Leistungserbringern sind, die von den Kostenträgern abhängig sind.
Konkret habe ich vor Kurzem mit der Geschäftsführung eines großen Jugendhilfeträgers gesprochen. Im Gespräch wurde deutlich, dass sie zunehmend feststellen, dass die Regelsysteme des kommunalen Trägers nicht mehr so stabil aufgestellt sind, wie man es aus der Vergangenheit gewohnt war. Ein Symptom dafür sei beispielsweise, dass es vermehrt zu längerfristigen Nicht-Erreichbarkeiten bei öffentlichen Stellen, beispielsweise beim ASD, komme, wodurch Fallzuständigkeiten unklar blieben. Und selbst wenn Stellen besetzt sind, handelt es sich oft nur um kurzfristige Besetzungen oder um Berufsanfänger:innen.
Das Ganze führt in der fallabhängigen sowie in der fallunabhängigen Arbeit nachvollziehbar zu erheblichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten.
Aus meiner Sicht ist das kein Einzelfall. Auch andere Institutionen und Organisationen sehen sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, die das Sozialwesen insgesamt an die Grenze der Funktionsfähigkeit führen.
Klingt dramatisch? Ist es auch. Am Schluss versuche ich deswegen, etwas optimistisch ein paar Hebel in den Blick zu nehmen, was doch getan werden könnte.
Aber der Reihe nach…
Systemeversagen allerorten
Ab und zu schreibe ich ja Beiträge, die eher einem Blick in die Glaskugel gleichen und in denen es um die Zukunft der Sozialen Arbeit geht (bspw. hier). Dass ich jedoch einmal einen Beitrag zur Zukunft der Sozialen Arbeit mit den technischen Details von Militärfahrzeugen beginnen würde, hätte ich auch nicht gedacht:
Der Blick darauf, dass die Bundeswehr seit Jahren versucht, Soldaten, Fahrzeuge und Waffensysteme digital miteinander zu vernetzen, zwei Techniker aber 400 Stunden für den Einbau eines Funkgeräts in einen einzigen Panzer brauchen und das Funkgerät aufgrund von Softwareproblemen dann trotzdem nicht funktioniert, lässt Fragen aufkommen:
- Warum wurden Funkgeräte gekauft, die sich technisch kaum oder nur mit riesigem Aufwand in die Fahrzeuge integrieren lassen?
- Warum sind die Softwareprobleme – wenn es um Digitalfunk geht – nicht vorher aufgefallen?
- Ich bin ja (aus Gründen) ein Freund externer Beratung, aber: Wer genau bekommt wofür genau die zusätzlichen 156 Millionen Euro, die das Verteidigungsministerium für externe Unterstützung ausgeben will, um die Probleme mit dem Digitalfunk in den Griff zu bekommen?
Was hat das mit der Zukunft der Sozialen Arbeit zu tun?
Meiner Meinung nach liegen die Probleme der Bundeswehr in einer Fülle von Regelungen, Gesetzen, bürokratischen Hürden und nicht funktionierenden Kooperationen verschiedener Bereiche innerhalb und außerhalb der Bundeswehr, die eigentlich zusammenarbeiten müssten. Ebenso zerklüftet wie die Bundeswehr ist laut Georg Cremer der Sozialstaat:
„Für jede Leistung ist, überspitzt gesagt, eine andere Behörde zuständig. Und wenn dann Leistungen gegenseitig angerechnet werden müssen, wird es kompliziert. Wenn etwa Menschen nicht wissen, wer für ihr Anliegen zuständig ist, Antragsverfahren sie überfordern oder die Abklärung von Zuständigkeiten die Hilfe verzögert” (ZEIT Nr. 47/2025, 4. November 2025).
Das Ganze wird noch anschaulicher, wenn das ifo Institut den Versuch der Quantifizierung aller Sozialleistungen im „Haus der sozialen Hilfe und Förderung“ mit Asterix und Obelix auf der Suche nach Passierschein A38 im „Haus, das Verrückte macht“ vergleichen (hier). Das ifo Institut hat 502 Sozialleistungen identifiziert und versucht, daraus einen gesetzesübergreifenden Überblick zu generieren, betonen aber, dass nicht gewährleistet werden kann, dass diese Liste abschließend und vollständig ist: “Es ist durchaus möglich, dass bestimmte Leistungen übersehen wurden.”
Wortwörtlich „unfassbar“, oder?
Das Unfassbare führt in der Bevölkerung zu dem Gefühl, dass „irgendetwas nicht mehr funktioniert“. Dieses Gefühl erklärt auch die Aussage von Harald Welzer, dass das Chaos bei der Deutschen Bahn mehr Schaden an der Demokratie angerichtet hat als echte Demokratiefeinde (00:01:12).
In der Gesellschaft kommt das Gefühl auf, dass Systeme nicht mehr funktionieren, was auch von Aladin El-Mafaalani hier im Podcast auf den Punkt gebracht wird mit der Aussage, dass „alle Systeme, alle (…) Veränderungen vornehmen” müssen (02:11:49).
Die Menschen haben das Gefühl, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, es auch nicht in den Griff bekommen. Also werden Idioten gewählt, die einfache, aber immer falsche Antworten auf komplexe Fragen liefern!
Und ähnlich ist es mit einem etwas spezifischeren Blick auf die Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Hier sei einführend nur auf den Artikel in der Zeit (50/2025) verwiesen, der unter dem großartigen Titel „Essen ist fertig“ die finanziellen Herausforderungen der Stadt Essen darlegt und auf ein Transparenzproblem verweist: „Die Kämmerer müssen zwar die Höhe der Ausgaben fürs Jugendamt einplanen, wissen aber nicht genau, was die Sozialarbeiter damit tun wollen. Doch die finanzielle Not, in der Städte und Gemeinden gerade sind, sei noch größer: Denn während die Kommunen sich schon lange über ihre Unterfinanzierung beschweren, fehlt jetzt auch Bund und Ländern das Geld.“
Anstatt aber auf einzelne Player, auf Einrichtungen, Jugendämter oder auf einzelne Organisationen der Sozialwirtschaft zu blicken, erweitere ich den Problemfokus und versuche, das Ganze in den Blick zu nehmen.
Einzelsystembetrachtungen
Die einleitenden Ausführungen richten den Blick stets nur auf ein einzelnes System, beispielsweise die Bundeswehr, die Sozialgesetzgebung oder die Bahn. Gleiches gilt meist auch für Berichte über Organisationen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
Die Pflegeeinrichtungen stehen vor dem Zusammenbruch. Die Jugendämter stehen vor dem Kollaps. Die Einrichtungen der Jugendhilfe kommen mit einem zunehmend schwierigeren Klientel nicht mehr zurecht und so weiter.
Es wird jeweils nur ein soziales System bzw. eine Organisation in den Blick genommen. Das reduziert Komplexität und es ist journalistisch einfacher aufzubereiten mit Überschriften wie „Jugendämter in Not: Kinder in Gefahr?” (hier) oder „Altwerden unbezahlbar: Die Pflege vor dem Kollaps“ (hier).
Katastrophen – hier und da. Und ja, ein großer Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit dem Versuch, die Katastrophen in den jeweiligen Organisationen abzuwenden, neue Lösungen zu suchen und zu versuchen, die real existierenden Probleme zu verringern.
Genauso zeigt der Blick in die jeweiligen Organisationen aber, dass dort Tag für Tag alles dafür getan wird, deren Überleben sicherzustellen. Das gelingt unter den herausfordernden Bedingungen der Sozialwirtschaft häufig (und nicht erst seit gestern) durch mehr oder weniger „brauchbare Illegalitäten“ (vgl. ausführlich Kühl, 2020), also durch das bewusste Abweichen von den formalen Strukturen.
Dieses Abweichen ist für das Funktionieren sozialer Organisationen hoch funktional und damit eben brauchbar illegal (vgl. spezifisch für Organisationen der Sozialwirtschaft Epe, 2022).
Ein Blick in die jeweiligen Organisationen zeigt außerdem, dass die Funktionsfähigkeit gerade dann, wenn die formalen Strukturen an ihre Belastungsgrenze kommen, über Personen aufrechterhalten wird. Mitarbeitende machen Überstunden, entscheiden individuell, was nicht mehr getan werden kann, oder nehmen im Extremfall Kinder, die von Kindeswohlgefährdung bedroht sind, mit zu sich nach Hause.
Der These des Beitrags folgend will ich hier aber einmal herauszoomen und nicht einzelne Player, sondern das Gesamtsystem Soziale Arbeit und die Kopplungen zwischen den Playern betrachten.
Den Problemfokus erweitern, oder: das Gesamtsystem Soziale Arbeit
Erst mit dem Herauszoomen wird es richtig komplex. Denn dann kommt das sozialwirtschaftliche Dreiecksverhältnis zwischen Kostenträger, Leistungserbringer und Leistungsberechtigten ins Spiel. Kurz zur Wiederholung:
- Kostenträger sind die Institutionen, die die finanziellen Ressourcen für die Erbringung sozialer Dienstleistungen bereitstellen. Neben Sozialämtern, Kranken- und Pflegekassen oder der Bundesagentur für Arbeit können auch Stiftungen oder andere Finanzierungsquellen als Kostenträger definiert werden. Die Kostenträger legen die Rahmenbedingungen fest, unter denen soziale Dienstleistungen erbracht werden. Dazu gehören die Art und der Umfang der Leistungen, die Zielgruppen und die verfügbaren finanziellen Mittel.
- Leistungserbringer sind Personen oder Organisationen der Sozialen Arbeit, die die tatsächlichen sozialen Dienstleistungen erbringen. Dazu zählen staatliche Behörden (beispielsweise Jugendämter), hauptsächlich aber die freien Träger der Sozialwirtschaft (private, freigemeinnützige Träger, privatfreiberufliche Anbieter und privatgewerbliche Anbieter). Die Leistungserbringer arbeiten gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien der Kostenträger, um die auf sozialpolitischen Entscheidungen basierenden Dienstleistungen zu erbringen. Die Existenz von Organisationen der Sozialen Arbeit ist somit von diesen Entscheidungen abhängig – „und dies sowohl hinsichtlich der elementaren Existenzmöglichkeiten (Finanzierung) als auch hinsichtlich der politisch gesetzten Bedingungen für die Leistungserbringung“ (Gesmann, Merchel, 2021:33).
- Zu nennen sind schließlich die Leistungsberechtigten, also die Klient:innen, Nutzer:innen oder Empfänger:innen sozialer Dienstleistungen – die Personen oder Gruppen, die die sozialen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie haben das Recht auf Zugang zu den von den Kostenträgern finanzierten und von den Leistungserbringern bereitgestellten sozialen Dienstleistungen. Sie können (und werden zunehmend – beispielsweise beim BTHG) in den Entscheidungsprozess über die Art und den Umfang der Unterstützung einbezogen werden.
Die Betrachtung der einzelnen Ecken des Dreiecks ist nachvollziehbar. Es wird jedoch erst interessant, wenn die Perspektive auf das „Dazwischen“ verändert wird, auf die strukturellen Kopplungen der Klient:innen mit den Leistungserbringern, vor allem aber auf die strukturellen Kopplungen der Leistungserbringer mit den Kostenträgern.
Mit struktureller Kopplung ist gemeint, dass sich das beobachtete System „auf Dauer auf einige Ereignisse in seiner Umwelt (z. B. auf Leistungen anderer Systeme in seiner Umwelt) einstellt und seine eigene Struktur daran ausrichtet“ (Hoegl, F., 2022, S. 262). Registriert ein System also ein für es irritationsrelevantes Ereignis in einem gekoppelten System, wird mit systemspezifischer Formenbildung darauf reagiert: „Geschieht Relevantes dort, geschieht auch etwas hier und umgekehrt“ (ebd.).
Die Kopplungen zwischen den hier betrachteten Ecken des sozialwirtschaftlichen Dreiecks lassen sich als enorm feste Kopplungen, besser sogar als Abhängigkeiten bezeichnen:
Organisationen der Sozialwirtschaft sind von relevanten Ereignissen bei den Kostenträgern abhängig, ebenso wie Klient:innen von Ereignissen bei den Leistungserbringern abhängig sind. Sie können nicht nur, sondern müssen kooperieren.
Einrichtungen der stationären Jugendhilfe müssen beispielsweise mit Jugendämtern kooperieren, da sie von deren Entscheidungen abhängig sind, die Kosten für die Unterbringung eines Jugendlichen zu übernehmen. Genauso erfordern dringende Fälle schnelle Absprachen zwischen Jugendamt und Einrichtung. Noch deutlicher wird die Notwendigkeit der Kooperation, wenn die Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) betrachtet werden:
Der ASD ist „verantwortlich für die Gestaltung einer sachgerechten Jugendhilfeinfrastruktur und die Implementierung einer zielorientierten und funktionierenden Steuerung von Kooperationsbeziehungen/professionellen Netzwerken sowie das Management der Schnittstellen in den Bereichen Prävention, Hilfe und Kontrolle bei Erziehungsproblemen und Kindeswohlgefährdung zu den Trägern der freien Jugendhilfe sowie zur Schule, zum Gesundheitswesen und zur Bundesagentur für Arbeit” (hier). Ebenso deutlich wird die Notwendigkeit der Kooperation bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Als Fachdienst im Jugendamt ist sie für die Bereitstellung der finanziellen Mittel für den jeweils festgestellten Jugendhilfebedarf nach dem SGB VIII sowie für die Steuerung der verwaltungstechnischen Abläufe im Rahmen der Hilfegewährung fachlich und rechtlich zuständig, wie es hier heißt.
Mit anderen Worten:
Um ihr Überleben zu sichern, sind Einrichtungen der Jugendhilfe auf eine gelingende Kooperation angewiesen und somit vom Funktionieren der Jugendämter abhängig. Gleiches gilt für stationäre Altenhilfeeinrichtungen, die auf eine gelingende Kooperation mit den Pflegekassen angewiesen sind. Auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind auf gelingende Kooperation angewiesen, da sie von den jeweiligen Trägern der Eingliederungshilfe abhängig sind.
Und gleichzeitig sind die Kostenträger von funktionierenden Leistungserbringern abhängig, da die Kostenträger die Leistungen nicht selbst erbringen können. Um im Beispiel zu bleiben kann das Jugendamt das Kindeswohl nur schützen, wenn es Einrichtungen gibt, die Kinder in Obhut nehmen oder in denen Jugendliche stationär untergebracht werden können. Kurz:
Beide Player müssen miteinander kooperieren.
Zur Unwahrscheinlichkeit gelingender Kooperation
Der zunächst allgemeine Blick auf Kooperation zeigt jedoch, dass Kooperation grundsätzlich unwahrscheinlich ist, wie Stefan Gesmann hier im Vortrag „Das Jugendamt (bzw. der ASD) und seine Kooperationspartner aus systemischer Perspektive“ (o.J., Folie 2) als These einführt.
Gesmann begründet die Unwahrscheinlichkeit gelingender Kooperation zusammenfassend wie folgt (ebd., Folie 31):
- „Kooperationssysteme sind soziale Systeme und damit Kommunikationssysteme.
- Damit der Prozess der Autopoiese im „Gang“ bleibt, müssen sich Kooperationssysteme abgrenzen. Zudem sind sie zwecks Reduktion von Komplexität auf Kommunikationsmuster angewiesen.
- Die Etablierung von Kommunikationsmustern (und damit das Gelingen von Kommunikation) wird in Kooperationssystemen erschwert durch
- tendenziell eher lose Kopplung von Aktionen und Akteuren,
- die sehr unterschiedlichen „Eigenlogiken“ (…) [der kooperierenden Systeme],
- das Fehlen des Mediums Macht als regulierende Größe,
- die sich nur schwerfällig entwickelnden informalen Spielregeln (Kopplung erfolgt nur temporär + Personen wechseln),
- die zahlreichen Irritationen, die im Zuge der nötigen Rückkopplungsschleifen entstehen.“
Bei „Kooperationsnotwendigkeiten“ bzw. Abhängigkeiten, wie sie im Verhältnis der Leistungserbringer zu den Kostenträgern bestehen, treffen alle genannten Punkte ebenfalls zu. Die ohnehin unwahrscheinliche Kooperation wird jedoch noch unwahrscheinlicher bzw. funktioniert nicht mehr, wenn ein Kooperationssystem (in diesem Fall die Kostenträger) die Kooperation aufgrund fehlender oder ständig wechselnder Mitarbeitender nicht mehr aufrechterhalten kann.
Hinter den brüchigen Kopplungen in der Sozialen Arbeit: Ein strukturelles Phänomen
Die beobachtbaren Instabilitäten sind, wie die Ausführungen zeigen, systemweite, strukturelle Phänomene und Symptome überlasteter und sich grundlegend verändernder Systeme.
Deutlich wird, dass Organisationen – und damit Leistungserbringer ebenso wie Kostenträger – keine statischen Gebilde sind, sondern lebendige, soziale Systeme. Sie reagieren kontinuierlich auf Veränderungen in ihren jeweiligen Umwelten, um ihr Überleben zu sichern.
Verschieben sich die Rahmenbedingungen – beispielsweise durch demografischen Wandel, Fachkräftemangel, veränderte Fallkonstellationen, zunehmende Komplexität der Aufgaben, politische Sparvorgaben oder gesetzliche Änderungen mit dahinter schlummernden Bürokratiemonstern –, versuchen Organisationen zunächst, dies durch interne Anpassungen zu kompensieren. Wie oben bereits angedeutet, übernehmen Personen und Teams zusätzliche Aufgaben, straffen Prozesse, setzen Prioritäten neu usw.
Solange die Kompensationsfähigkeit und damit die Belastbarkeit noch ausreicht, bleibt das System nach außen hin funktionsfähig. Doch die Anpassungsstrategie hat Grenzen.
Mit zunehmender Belastung werden die – in Organisationen der Sozialwirtschaft ohnehin kaum vorhandenen – Puffer (Slack Resources) aufgebraucht, Redundanzen verschwinden und die Anpassungsfähigkeit nimmt ab. Was früher flexibel aufgefangen werden konnte, führt nun zu Verzögerungen und Ausfällen. Das System gerät an den Rand seiner Funktionsfähigkeit – oder sogar darüber hinaus. Die sichtbaren Symptome wie Nicht-Erreichbarkeit, unklare Zuständigkeiten, Personalfluktuation und Verzögerungen sind Ausdruck dieses Erschöpfungszustandes.
Entscheidend ist jedoch das Verständnis, dass die Probleme nicht am „Versagen“ einzelner Personen liegen, sondern an den Verhältnissen, unter denen diese agieren müssen.
Kurzfristige Appelle an „bessere Erreichbarkeit” oder die Forderung nach „besserer Bezahlung” mögen nachvollziehbar sein, greifen aber zu kurz. Sie behandeln Symptome, ohne die zugrunde liegenden Strukturprobleme zu adressieren.
Selbst kurzfristig mehr Personal – wo auch immer dieses herkommen soll – hilft wenig, wenn die Fluktuation hoch bleibt, die Einarbeitung in die hochkomplexen Arbeitsfelder unzureichend ist und sich die Systemüberlastung damit einfach auf eine größere Zahl von Personen verteilt.
Sieben Hebel, oder: Brüchige Kopplungen in der Sozialen Arbeit handlungsfähig gestalten
Wie oben bereits geschrieben, soll der Beitrag meine Beobachtungen widerspiegeln und keine „Rezepte“ liefern. Problembeschreibungen sind gut und wichtig. Ich bin auch kein Freund davon, immer und unmittelbar „lösungsorientiert“ zu agieren, sondern möchte zunächst die Probleme verstehen.
Das sollte mit den vorherigen Ausführungen aber geschehen sein. Die darauffolgende Frage lautet:
Wie können die Beteiligten – Leistungserbringer auf der einen und Kostenträger auf der anderen Seite – ihre Handlungsfähigkeit bewahren, wenn notwendige Kopplungen zunehmend brüchig werden?
Antwortmöglichkeiten liegen sicher nicht in einer noch stärkeren Kompensation durch die ohnehin enorm belasteten Mitarbeitenden, sondern in der bewussten Gestaltung der Rahmenbedingungen. Mit den folgenden sieben „Hebeln” versuche ich, einen Orientierungsrahmen dafür zu skizzieren:
Hebel 1: Systemgrenzen klären – Verantwortung bewusst definieren
Der erste Schritt ist die Klärung der Systemgrenzen. Die Beteiligten – Leistungserbringer ebenso wie Kostenträger – müssen sich deutlicher als bislang bewusst machen, was zu ihrem Auftrag gehört und was nicht, und dies aktiv definieren. Dadurch wird die jeweilige Verantwortung der Organisation klarer. Das klingt zunächst simpel, ist in der Praxis jedoch nicht nur komplex, sondern auch emotional aufgeladen.
In vielen Organisationen der Jugendhilfe (um ein Beispiel herauszugreifen) gibt es beispielsweise eine ausgeprägte Kultur des „Auffangens von allen”.
Diese Haltung ist grundsätzlich wertvoll. Sie entspringt der professionellen Identität der Menschen in der Sozialen Arbeit, die tief verankert ist und Gott sei Dank „helfen wollen”. Sie ist damit Ausdruck der Verantwortung der Mitarbeitenden gegenüber der jeweiligen Klientel – im Beispiel gegenüber den Kindern und Jugendlichen.
Wenn diese „organisationale Grundhaltung” jedoch dazu führt, dass systematisch Aufgaben übernommen werden, die eigentlich in der Verantwortung anderer Systempartner liegen, wird sie aus Perspektive der Organisationen dysfunktional und aus Perspektive der Mitarbeitenden ungesund. Nicht umsonst sind die Burnout-Raten in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft extrem hoch (und weiter steigend).
Ein praktisches Beispiel: Ein Träger der Jugendhilfe stellt fest, dass sich Hilfeplanverfahren massiv verzögern, weil der ASD überlastet ist. Die Fachkräfte beginnen, die Koordination zu übernehmen, Termine vorzubereiten und Protokolle zu schreiben – Aufgaben, die formal beim Kostenträger liegen.
Kurzfristig funktioniert das System besser. Mittelfristig führt die Zuständigkeitsverschiebung jedoch zu einem neuen Muster und damit zur neuen Normalität. Langfristig hat der Leistungserbringer zusätzliche Aufgaben informell und dauerhaft übernommen, ohne dass dies reflektiert, vereinbart oder finanziert wurde.
Systemgrenzen zu klären bedeutet nicht, sich zu verweigern oder bestehende Verantwortung abzulehnen. Es bedeutet vielmehr, bewusst zu entscheiden, welche zusätzlichen Aufgaben temporär übernommen werden können, ohne die Kernaufgaben zu gefährden und/oder die Mitarbeitenden zu überlasten. Diese Entscheidungen müssen transparent kommuniziert werden: gegenüber den Mitarbeitenden, gegenüber dem Kostenträger und gegenüber den Adressaten der Hilfe.
Ein Instrument kann dabei eine systematische „Aufgaben-Inventur“ sein:
- Welche Tätigkeiten führen wir aktuell aus?
- Welche davon gehören zu unserem vereinbarten Auftrag?
- Welche sind Kompensationsleistungen für Systemausfälle?
Ziel ist, Klarheit zu schaffen, sich bewusst werden über Verantwortlichkeiten und die Grundlage für bewusste Entscheidungen zu bilden, anstatt in eine schleichende Überlastung zu laufen.
Hebel 2: Irritationen deuten – Probleme als Signale verstehen
Wenn selbst dort, wo „früher” brauchbare Illegalitäten stabilisiert haben, Abläufe nicht mehr funktionieren, liegt die naheliegende Interpretation nahe:
Es gibt ein Problem, das gelöst werden muss!
Fraglich ist jedoch, ob das offensichtlich wahrgenommene Problem nicht nur ein Symptom für „echte” Probleme dahinter ist. Die unmittelbaren Störungen und Probleme sind häufig Signale für tieferliegende Veränderungsnotwendigkeiten im jeweiligen System.
So signalisiert die wiederholte Nicht-Erreichbarkeit einer bestimmten Stelle beim Kostenträger beispielsweise möglicherweise keine individuelle Überlastung, sondern eine strukturelle Unterbesetzung. Daneben kann ein Problem auch in der Fehlbesetzung von Stellen liegen, was zu Überforderung und in der Folge zu häufigem Personalwechsel führt. Anstatt offene Stellen nur schnell nachzubesetzen, sollte man sich daher fragen, wie eine langfristige Kopplung von Person und Organisation wahrscheinlicher werden kann. Geht es um das Onboarding, die Arbeitsplatzattraktivität oder um unklare Zuständigkeiten, die mit Rollenkonflikten einhergehen?
Diese Signale wahrzunehmen und zu hinterfragen, bedeutet, einen Schritt zurückzutreten, zu beobachten und zu fragen:
- Was sagt das Problem über das System?
Anstatt frustriert zu sein, dass „der ASD schon wieder nicht reagiert“, lohnt es sich, folgende Fragen zu stellen: Was könnte die wiederkehrende Nicht-Reaktion über die aktuelle Situation und die aktuellen Herausforderungen des ASD aussagen? Welche Rückschlüsse können wir daraus für unsere eigene Strategie und Arbeitsweise ziehen?
Diese Beobachtung 2. Ordnung oder – mit anderen Worten – die Beobachtung der eigenen Beobachtungen (hier mehr dazu) verändert die Position der Organisation fundamental und eröffnet Möglichkeiten:
Aus passiv Betroffenen werden aktive Beobachter der Beobachtungen. Daraus lassen sich Muster erkennen und in veränderte Handlungsstrategien übersetzen.
Ein Leistungserbringer, der erkennt, dass die Instabilität beim öffentlichen Träger strukturell bedingt und mittelfristig anhaltend ist, wird andere Entscheidungen treffen als einer, der von temporären Ausnahmesituationen ausgeht.
Noch konkreter können regelmäßige Reflexionsrunden im Leitungsteam durchgeführt werden, in denen nicht nur über einzelne Problemfälle, sondern auch über beobachtbare Muster in der eigenen Organisation sowie beim Kostenträger gesprochen wird:
- Welche Irritationen treten wiederkehrend auf?
- Was könnten sie signalisieren?
- Welche Hypothesen haben wir über die Systemdynamiken?
Diese Deutungsarbeit ist anspruchsvoll und erfordert Raum, Zeit und eine Kultur, in der Unsicherheit und Nicht-Wissen artikuliert werden dürfen.
Hebel 3: Kooperationen neu strukturieren – tragfähige Kontaktarchitekturen schaffen
Wie oben ausgeführt, ist eine Kooperation unwahrscheinlich. Wenn dann auch noch einzelne Ansprechpersonen auf Seiten der Kooperationspartner nicht mehr verlässlich erreichbar sind, ist es nicht hilfreich, die bisherigen Kommunikationswege intensiver zu nutzen. Stattdessen sind neue Kooperationsstrukturen zu gestalten, um wieder tragfähige Kontaktarchitekturen zu etablieren, die auch unter instabilen Bedingungen funktionieren.
Dies kann konkret die Abkehr vom Prinzip der Einzelfallsteuerung zugunsten strukturierter Austauschformate bedeuten. Anstatt bei jedem Anliegen die individuelle Zuständigkeit zu klären, können beispielsweise wenige, dafür aber feste Jour-Fixe-Termine mit dem Kooperationspartner etabliert werden, in denen verschiedene Fälle gebündelt besprochen werden. Dadurch kann die Zahl der Kontaktversuche reduziert und die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, tatsächlich ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen.
Denkbar ist auch die Bildung von „Kooperationstandems“, bei denen je zwei Personen auf Träger- und Leistungserbringerseite füreinander die primären Ansprechpartner sind – mit klarer Vertretungsregelung. Dies schafft Redundanz und verhindert, dass Personalwechsel oder Urlaub zum unmittelbaren Kommunikationsausfall führen.
Zu betonen ist, dass neue Strukturen nicht automatisch zu mehr Bürokratie führen müssen. Im Gegenteil können klare, ritualisierte Austauschformate oft effizienter sein als der scheiternde Versuch, die formal richtige Ansprechperson bzw. dauerhafte, aber ebenfalls nicht mehr verlässlich funktionierende Umwege zu finden. Entscheidend ist dabei, dass die neuen Strukturen gemeinsam mit den Kooperationspartnern (also von Kostenträger und Leistungserbringer) vereinbart und nicht einseitig eingefordert werden. Es ist notwendig, in den Dialog zu treten und zu klären, welche Formate für beide Seiten tragfähig sind.
Manche Organisationen und vor allem die Mitarbeitenden in den Organisationen der Sozialwirtschaft haben auch gute Erfahrungen mit „Eskalationspfaden“ gemacht. Gemeint sind damit klar definierte Wege, wie vorgegangen wird, wenn reguläre Kommunikationswege nicht mehr funktionieren:
- Wer wird informiert?
- In welchem Zeitraum?
Dies nimmt Druck aus komplexen, akuten Situationen und gibt den Mitarbeitenden Orientierung und Handlungssicherheit.
Hebel 4: Selbstbestimmt agierende Teamarbeit stärken – interne Routinen und Entscheidungsstrukturen festigen
Je instabiler das Umfeld und die Funktionsfähigkeit der Leistungserbringer ist, desto wichtiger wird die interne Stabilität. Organisationen, die klare Regeln, Prozesse, Routinen und Entscheidungswege (und damit Rollen und Zuständigkeiten) haben, können äußere Turbulenzen besser abfedern als solche, deren interne Ordnung diffus ist.
In diesem Kontext bedeutet es zunächst, selbstbestimmt agierende Teamarbeit zu stärken, indem interne Entscheidungskompetenzen geklärt und – sofern notwendig – erweitert werden:
- Welche Entscheidungen können und sollen in der Organisation selbst getroffen werden, ohne auf externe Rückmeldungen warten zu müssen?
Dies kann die Handlungsfähigkeit erheblich steigern und Abhängigkeiten verringern.
Es geht gleichzeitig um die Festigung von Regeln und Routinen bzw. die klare Definition von Abläufen für Standardsituationen, die transparente Beschreibung von Kommunikations- und Entscheidungswegen sowie die Strukturierung von Besprechungsformaten.
Regeln und Routinen wirken zwar „bürokratisch”. Sie wirken jedoch gleichzeitig wie ein Stabilisator und ermöglichen effizientes und effektives Handeln, auch unter Stress. Den Mitarbeitenden wird damit Orientierung und Sicherheit gegeben. Ein Blick in die Funktionsweise von sogenannten „Blaulicht-Organisationen“ wie Feuerwehren, Polizei und Rettungsdiensten lohnt sich hier. Diese Organisationen reagieren auf Krisen. Deutlich wird, dass diese nicht „ungeplant selbstorganisiert”, sondern sehr klar durchorchestriert agieren (müssen), um in der Krise funktionsfähig zu bleiben.
Zum vierten Hebel noch ein abschließender Punkt: Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Stärkung kollegialer Beratungsstrukturen. Interne Formate der Fallreflexion, der Supervision und der kollegialen Beratung sollten nicht nur in Krisen, sondern ganz allgemein Standard sein. Ja, ich weiß, dass das in vielen Organisationen so ist. Ich kenne aber auch Beispiele, in denen Supervision aufgrund der Kosten nur sehr spärlich in Anspruch genommen werden darf. Die Kosten, die durch fehlende Supervision (oder auch methodisch-professionelle kollegiale Beratung) entstehen, werden jedoch kaum dagegen aufgewogen.
Praktisch kann dies auch bedeuten, die Investitionen in Fortbildung und Methodenentwicklung im eigenen Team auszubauen, interne Wissensmanagementsysteme aufzubauen, Reflexionsräume zu schaffen und regelmäßige Supervision für selbstbestimmt agierende Teams zu etablieren.
Hebel 5: Unsicherheit als Kompetenzrahmen begreifen – Räume für Reflexion und Deutung schaffen
In instabilen Kontexten wird Unsicherheit zum Dauerzustand. Die klassische Erwartung an „die eine starke Führungsperson“ – Orientierung geben, Entscheidungen treffen und Sicherheit vermitteln – stößt an ihre Grenzen, wenn die Zukunft nicht prognostizierbar ist und sich die Rahmenbedingungen ständig ändern.
Hier kann ein Perspektivwechsel helfen: Unsicherheit wird dabei nicht als zu überwindendes Problem, sondern als neuer Handlungsrahmen verstanden. Dieser andere Blick ist übrigens nicht nur in Organisationen der Sozialwirtschaft hilfreich, sondern würde auch unserer Gesellschaft insgesamt guttun.
Die dahinterliegende Kompetenz für Führungskräfte besteht nicht mehr darin, alle Antworten zu haben, sondern die richtigen Fragen zu stellen, Entwicklungen zu beobachten, Hypothesen zu bilden, zu testen und die Ergebnisse zu überprüfen, um dann gemeinsam mit dem Team tragfähige und flexible Wege zu entwickeln.
Dazu sind jedoch die in Hebel 4 angesprochenen organisationalen Reflexionsräume notwendig, in denen Unsicherheit artikuliert werden darf. Führungskräfte, die eigene Zweifel und Nicht-Wissen transparent machen, verunsichern unter Umständen. Sie erhöhen jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Kultur entwickelt, in der auch Mitarbeitende Unsicherheit äußern können, ohne dass ihre Kompetenz oder Professionalität infrage gestellt wird.
Aus dieser Offenheit kann die Fähigkeit einer Organisation wachsen, gemeinsam komplexe Situationen zu verstehen und angemessen zu handeln.
In der Praxis können regelmäßige Reflexionsrunden helfen, in denen nicht über einzelne Fälle, sondern über Dynamiken und Muster gesprochen wird. Auch hier kommen Supervisionen oder Beratungssettings ins Spiel, die nicht nur individuelle Belastungen, sondern auch systemische Fragestellungen bearbeiten. Ebenso können gemeinsame Klausurtage hilfreich sein, bei denen nicht das nächste Thema abgearbeitet, sondern Raum für das Heraustreten, das Beobachten und die strategische Reflexion geboten wird – ohne unmittelbaren Handlungsdruck.
Unsicherheit als Kompetenzrahmen bedeutet, dass man sich von der ohnehin illusorischen Vorstellung vollständiger Kontrolle verabschieden sollte: Organisationen können ihre Umwelt nicht kontrollieren, aber sie können Fähigkeiten entwickeln, um besser auf Veränderungen zu reagieren. Diese Fähigkeit, die sich vielleicht am besten mit dem Begriff der „organisationalen Resilienz” zusammenfassen lässt, ist in instabilen Zeiten wertvoller als jeder noch so detaillierte Fünfjahresplan.
Hebel 6: Iterativ handeln – temporäre, lernorientierte Lösungen statt starrer Konzepte
Zwar wurde oben die Bedeutung von Regeln in Krisen beschrieben. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns in Organisationen ausschließlich auf klassische Planungsinstrumente verlassen, die von einer prognostizierbaren Zukunft ausgehen. Das mechanistische Vorgehen, bei dem man die Situation analysiert, ein passendes Konzept entwickelt und umsetzt und anschließend das Ergebnis evaluiert, funktioniert in stabilen Umwelten gut. In instabilen Kontexten führt es jedoch zu Frustration, da sich die Situation bereits verändert hat, bevor das Konzept entwickelt, geschweige denn umgesetzt werden konnte.
Hier kann das bereits angesprochene iterative, auch „agile” Vorgehen helfen. Dabei geht es darum, schnelle, temporäre Lösungen zu entwickeln, auszuprobieren, auszuwerten und anzupassen.
Anstelle eines perfekt durchdachten Gesamtkonzepts werden begrenzte, überschaubare Schritte unternommen, aus denen gelernt werden kann. „Good enough for now and safe enough to try“ lautet der Leitsatz – nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus der Einsicht, dass die Wirkung von Interventionen in komplexen Systemen nie vollständig vorhersagbar ist.
Konkret wäre denkbar, statt eines umfassenden neuen Kommunikationskonzepts für den jeweiligen Kooperationspartner zunächst einen wöchentlichen Telefontermin für drei Monate zu etablieren und dabei zu beobachten:
- Funktioniert das?
- Was verändert sich?
- Was lernen wir?
Auf Basis dieser Erfahrungen kann entschieden werden, ob das Format beibehalten, angepasst oder ersetzt wird.
Iteratives Handeln erfordert den Mut zum Experimentieren und zum gemeinsamen Lernen. Fehler dürfen nicht als Versagen Einzelner interpretiert werden, sondern müssen als Erkenntnisquelle betrachtet werden. Anstatt an eine „Fehlerkultur” zu appellieren, sind Strukturen zu schaffen, in denen Experimente erlaubt sind und aus Fehlern gelernt werden darf.
Praktisch bedeutet das kürzere Planungshorizonte, häufigere Überprüfungen und mehr Flexibilität in der Ressourcenplanung. Budgets sollten nicht für das gesamte Jahr festgelegt werden, sondern quartalsweise überprüft und angepasst. Darüber hinaus sollten alle Konzepte, Dokumente, Regelungen, Vereinbarungen usw. als „Living Documents“ verstanden werden, die regelmäßig aktualisiert werden.
Hebel 7: Übergreifende Lagebilder für gemeinsames Verständnis schaffen – Austausch ermöglichen und Muster sichtbar machen
Ich komme gerade von der Jahrestagung des „Bündnisses katholischer Träger der offenen Ganztagsbildung im Erzbistum Köln“ in Köln zurück. Aus systemtheoretischer Perspektive habe ich dort auf die Gestaltungsmöglichkeiten organisationaler Resilienz von Teams und Trägerorganisationen der offenen Ganztagsbildung geschaut. Allein die Darstellung, dass in diesem Kontext nicht nur die Kopplungen des sozialwirtschaftlichen Leistungsdreiecks relevant sind, sondern auch die Schule als „Player” hinzukommt, führte bei einigen Teilnehmerinnen zu einem Aha-Erlebnis.
So wurde unter anderem deutlich, dass die Leistungserbringer – in diesem Fall die Teams und Einrichtungen der OGS – viele ähnliche Herausforderungen erleben, aber wenig voneinander wissen. Dafür gibt es entsprechende Veranstaltungen. Übergreifend lässt sich die Perspektive dahingehend erweitern, dass es verbandsintern einige Verständigungsinitiativen gibt – dafür sind die Verbände als Mitgliedsverbände da. Verbandsübergreifend gibt es jedoch nicht mehr viele solcher Räume.
Ähnlich ist es auf Seiten der Kostenträger: Ihnen ist bewusst, dass sie ähnliche Herausforderungen haben, und oftmals sind sie sich auch bewusst, dass ihre bisher etablierten Strukturen an die Grenze der Funktionsfähigkeit kommen.
Und – um das Beispiel OGS aufzugreifen – gehe ich davon aus, dass auch innerhalb des Systems Schule oder zumindest innerhalb vieler Schulen klar ist, dass Systeme – das Bildungssystem oder die jeweilige Schule – an Belastungsgrenzen zunehmend deutlich werden.
All dies wird sogar in Zeitungsartikeln und damit nach außen verdeutlicht: Jugendämter schreiben Brandbriefe (bspw. hier), in Einrichtungen der Jugendhilfe ist es ähnlich (bspw. hier) und aus Schulen finden sich ähnliche Artikel (bspw. hier).
Jeder kämpft für sich mit Überlastung, Nichterreichbarkeit, Zuständigkeitsproblemen und Verzögerungen. Diese Vereinzelung ergibt sich aus meiner Sicht aus dem fehlenden Verständnis der jeweiligen Herausforderungen und der Funktionslogiken der Systeme untereinander.
Das ist ineffizient und verschenkt Potenziale.
Mit „kollektiven Lagebildern” meine ich, dass Leistungserbringer aus ähnlichen Handlungsfeldern und Kostenträger zunächst einmal unter sich zusammenkommen, um ihre Beobachtungen auszutauschen und gemeinsame Deutungen zu entwickeln. Dabei geht es noch nicht um Lösungen, sondern vorerst um übergreifende Fragen wie:
- Was sind wiederkehrende Muster?
- Wo sind Engpässe?
- Welche Lösungsansätze haben sich bei wem bewährt?
- Welche Veränderungen in der Landschaft beobachten wir, und was bedeutet das für unsere Strategie?
Dieser systeminterne Austausch schafft Entlastung durch Solidarisierung („Wir sind nicht allein mit diesen Erfahrungen“) und liefert handlungsrelevantes Wissen, das die Grundlage für abgestimmte Handlungsstrategien bildet.
Werden ähnliche Probleme innerhalb des Systems identifiziert und offen angesprochen, kann gemeinsam auf „die andere Seite“ (Kostenträger bzw. Leistungserbringer) zugegangen werden – nicht als Anklage, sondern als Angebot zur gemeinsamen Problemlösung. Dies ist wirksamer als individuelle Beschwerden und signalisiert die Bereitschaft zu konstruktiver Kooperation im Sinne des gemeinsamen Auftrags, nämlich der bestmöglichen Versorgung der Klienten.
Praktisch kann dies bedeuten, dass sich zunächst regionale Foren der Kostenträger und Leistungserbringer bilden. In diesen Foren finden moderierte Reflexionsrunden statt, die nicht fachthemenbezogen sind, sondern dem Austausch und dem gegenseitigen Verständnis dienen. Im zweiten Schritt ist dann die jeweils andere Seite zu beteiligen, um ein systemübergreifendes Verständnis zu schaffen und zu schärfen.
Wichtig ist, dass diese Formate nicht zu weiteren Gremiensitzungen werden, in denen entweder nur gejammert oder hinter verschlossenem Visier das gegenseitige Versagen vorgeworfen wird. Aus meiner Sicht ist eine Moderation relevant, damit die Austauschforen strukturiert und lösungsorientiert gestaltet werden. Moderation kann dabei helfen, konstruktiv zu bleiben, Muster herauszuarbeiten und vom Problem zur Lösung zu gelangen.
Solche Formate erfordern Ressourcen – Zeit, gegebenenfalls externe Begleitung, Bereitschaft zur Teilnahme – aber sie zahlen sich aus durch effektivere Zusammenarbeit und geteilte Problemlösungskompetenz.
Fazit, oder: Brüchige Kopplungen in der Sozialen Arbeit dynamisch stabilisieren
Respekt, wenn es Ihnen gelungen ist, bis hierher zu lesen. Die herausfordernden Beobachtungen des „Systemversagens” erfordern aus meiner Sicht jedoch mehr als kurzfristige Lösungen.
Der Versuch, neue Probleme mit alten Lösungen anzugehen, wurde schon von Einstein als Wahnsinn erachtet. Es braucht also ein echtes Überdenken und Neugestalten bisheriger Systeme. Dies erleben wir nicht nur in der Sozialwirtschaft, sondern es lässt sich auch wunderbar auf das Gesundheits-, das Bildungs- oder das Rentensystem übertragen.
Wir brauchen in all diesen Systemen mehr als Reparatur. Prozessinnovation, also die Veränderung und Optimierung bestehender Prozesse, reicht nicht mehr aus. Wir brauchen Veränderungen zweiter Ordnung, also die Veränderung von Mustern, die ein System zur Reduktion von Komplexität herausgebildet hat, oder sogar Veränderungen dritter Ordnung.
Gemeint sind damit (bspw. hier von Ruth Seliger) Veränderungen der hinter den Mustern liegenden Konstruktionen und damit Veränderungen der „Grundwerte und Prinzipien, die den ‚Bauplan‘ (…) bilden“ (ebd.). Veränderungen dritter Ordnung bedeutet einen Paradigmenwechsel. Seliger schreibt sehr passend:
„Unsere Sprache suggeriert, dass Transformation einen ‚Gegen-Stand‘ beschreibt, ein ‚Ding‘, das man erkennen könnte. Aber Transformation ist kein ‚Ding‘, sie entsteht durch Tätigkeiten von Menschen, die etwas – sich selbst, ihre Organisation, die Gesellschaft – verändern. Es gibt nur den Prozess des Transformierens“ (ebd.).
Aus dieser Perspektive liefert auch dieser Beitrag keinen „3-Punkte-Plan“, kein Rezept und auch keine für alle Organisationen der Sozialwirtschaft in allen Bundesländern und Arbeitsfeldern gleichermaßen geltende Beschreibung aktueller Zustände. Er ist vielmehr eine Zusammenfassung meiner wiederholt an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Gesprächen gemachten Beobachtungen – meine Beobachtung 2. Ordnung, sozusagen.
Vielleicht lässt sich die zentrale Beobachtung, die sich durch die Überlegungen zieht, in folgendem Satz zusammenfassen:
Resilienz entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Klarheit.
In einer Zeit, in der sich die Rahmenbedingungen der Sozialwirtschaft fundamental verändern, ist der Versuch, diese Veränderungen zu kontrollieren oder zu steuern, bzw. sie durch verstärkte Kompensation auf dem Rücken einzelner Mitarbeitender aufzufangen, zum Scheitern verurteilt.
Was stattdessen – aus meiner Sicht – besser trägt, ist Klarheit: Klarheit als Person, Organisation, System und systemübergreifend über eigene Grenzen, Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse sowie über Systemdynamiken und damit über interne und externe Struktur- und Funktionslogiken.
Die zunehmende Brüchigkeit und Instabilität der für gelingende soziale Arbeit notwendigen Verbindungen zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern ist kein vorübergehendes Resultat bedauerlicher Umstände, sondern Ausdruck tiefgreifender Transformationsprozesse im Gesamtsystem.
Diese Transformation wird anhalten – die Instabilität wird zur neuen Normalität. Entscheidend ist nicht, „wann alles wieder wie früher wird”, sondern das Lernen, in dieser Instabilität handlungsfähig zu bleiben.
Erste Antworten liegen nicht im Aktivismus, sondern zunächst im Beobachten und Wahrnehmen sowie der Reflexion der gemachten Wahrnehmungen.
Aufbauend auf den Wahrnehmungen der sich zeigenden Muster können Organisationen dann beginnen, Systemgrenzen zu klären, Irritationen und Muster als Signale zu deuten, Kooperationen neu zu strukturieren, Selbstorganisationsfähigkeiten zu stärken, Unsicherheiten als Möglichkeiten zu begreifen, iterativ zu handeln und kollektive Lagebilder zu schaffen.
Daraus – so vielleicht eine Hoffnung – kann „dynamische Stabilität“ entstehen, die es Organisationen – Kostenträgern wie Leistungserbringern – ermöglicht, kontinuierlich mit Veränderungen umzugehen.
Zum Schluss noch eine Schiffsmetapher, die gerne genutzt wird:
Dynamische Stabilität lässt sich mit einem Segelschiff vergleichen, das durch geschickte Navigation auch bei schwerem Seegang seinen Kurs hält – im Unterschied zum Anker, der Bewegung verhindert.
Quellen:
- Epe, H. (2022): Dominierende Informalität in sozialen Organisationen als Herausforderung für die Organisationsentwicklung. URL: https://www.ideequadrat.org/dominierende-informalitaet-in-sozialen-organisationen/
- Gesmann, S., Merchel, J. (2021): Systemisches Management in Organisationen der Sozialen Arbeit: Handbuch für Studium und Praxis. Zweite Auflage. Systemische soziale Arbeit. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Hoegl, F. (2020): Kopplung. In: v. Wirth, Kleve, H. (Hrsg., 2022): Lexikon des systemischen Arbeitens. Grundbegriffe der systemischen Praxis, Methodik und Theorie. 2. Auflg., Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH. S. 262 – 263.
- Kühl, S. (2020): Brauchbare Illegalität.Vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen. Frankfurt: campus Verlag.

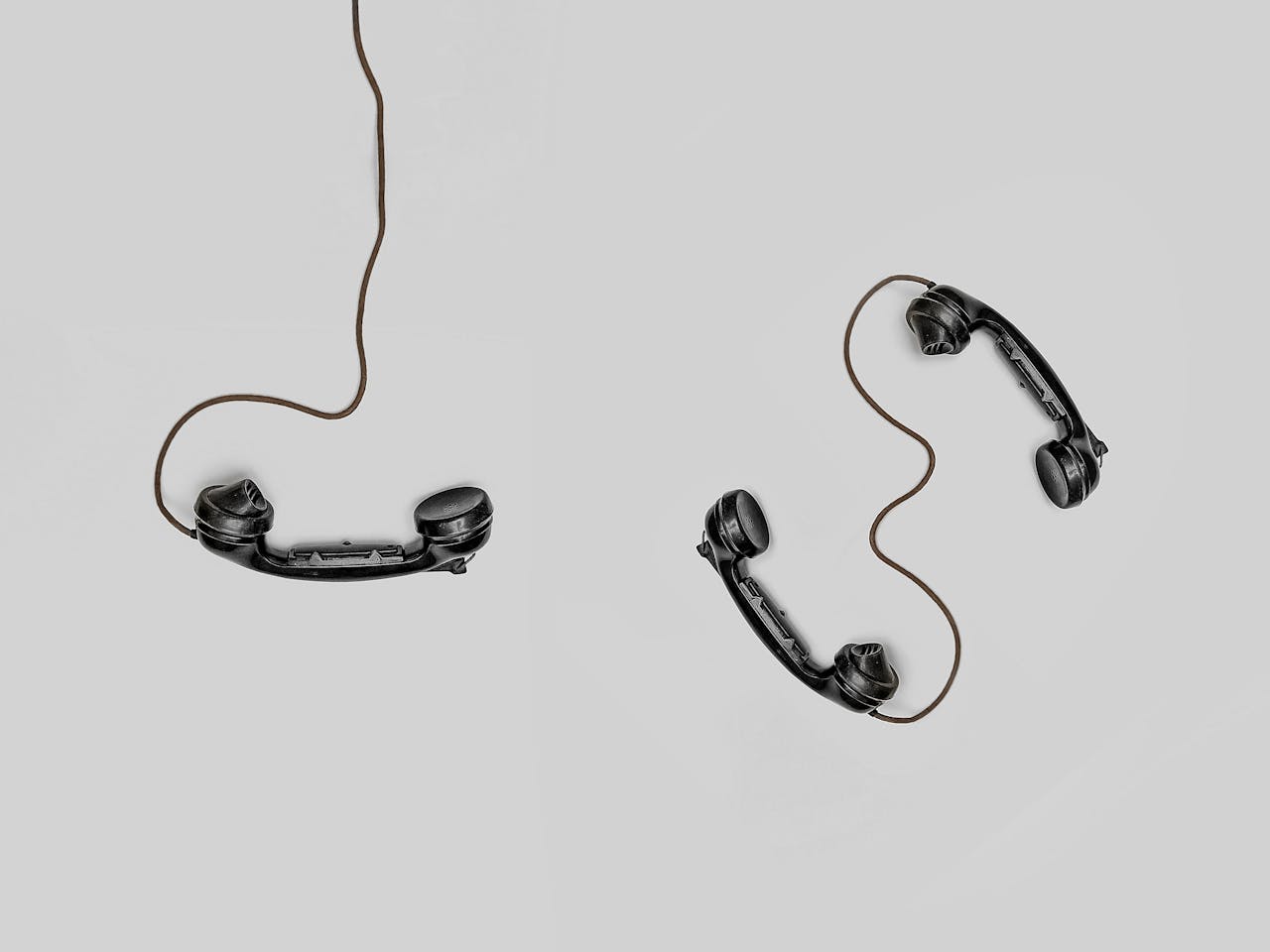
Neueste Kommentare